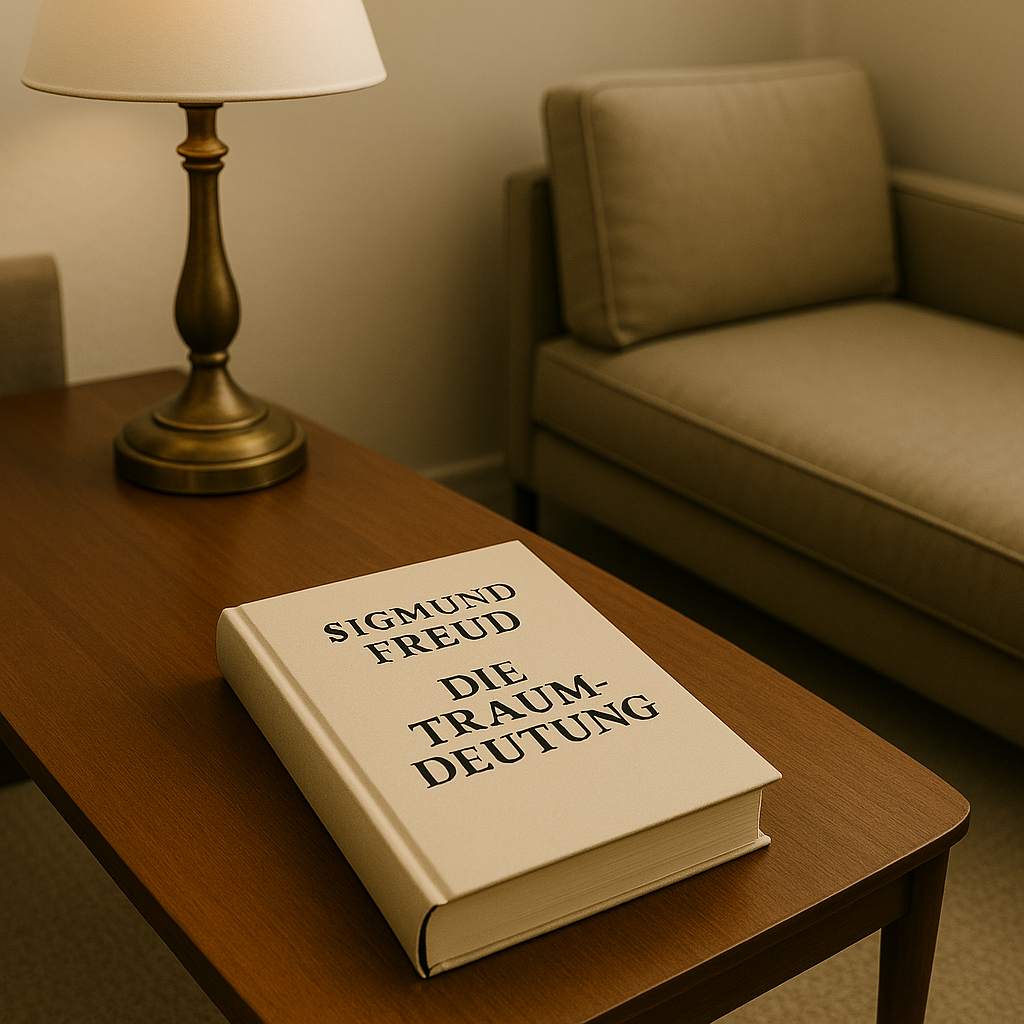
Historische Entwicklung der Psychoanalyse
Die Geschichte der Psychoanalyse beginnt Ende des 19. Jahrhunderts mit Sigmund Freud (Vgl. u.a. DGPT). Freud, ein österreichischer Neurologe, entwickelte um 1895–1900 die grundlegenden Theorien (etwa die Traumdeutung, 1900) und Methoden der Psychoanalyse. Seine Ideen fanden im deutschsprachigen Raum rasch Widerhall: Bereits 1908 fand in Salzburg der erste psychoanalytische Kongress statt, und es entstanden lokale Arbeitsgruppen in Städten wie Wien, Berlin und Zürich. Freud selbst war in akademischen Kreisen umstritten, doch eine wachsende Anhängerschaft von Ärzten und Intellektuellen (etwa Karl Abraham in Berlin, Max Eitingon, Sandor Ferenczi u.a.) trug die Psychoanalyse in die breite Diskussion. Allerdings blieb er personell und institutionell meist außerhalb der Universitätssysteme. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Psychoanalyse in Deutschland einen Aufschwung. 1920 wurde in Berlin das Berliner Psychoanalytische Institut (BPI) gegründet – finanziert von Max Eitingon – und eine Poliklinik eröffnet, die auch weniger zahlungskräftigen Patienten psychoanalytische Behandlung ermöglichte. In Berlin etablierte sich damit das erste systematische Ausbildungsprogramm (Seminare, persönliche Lehranalyse und Supervision), das später weltweit zum Standard der Analytikerausbildung wurde. Ähnliche Institute und Ambulatorien entstanden in den 1920er Jahren auch in Frankfurt, München und anderen Städten. Die Weimarer Zeit war geprägt von offener Auseinandersetzung mit Freuds Ideen; psychoanalytische Konzepte beeinflussten Kunst, Literatur und Pädagogik. Gleichzeitig kam es zu ersten internen Schulenbildungen und Spaltungen: Bereits 1911 hatte sich Alfred Adler mit seiner Individualpsychologie abgespalten, 1913 C. G. Jung mit seiner Analytischen Psychologie. Diese Schulen verwarfen Teile der freudschen Libidotheorie, blieben aber im weiteren Sinne der Tiefenpsychologie zuzurechnen. Trotz solcher Differenzen florierte die psychoanalytische Bewegung in der späten 1920er-Jahre – bis zu den politisch bedingten Einschnitten 1933.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 geriet die Psychoanalyse in Deutschland in existenzielle Gefahr. Freud’s Schriften wurden bei der ersten Bücherverbrennung öffentlich verbrannt und die Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG), die von vielen jüdischen Analytikern geprägt war, musste sich „gleichschalten“. Im März 1933 entfernte die DPG ihre jüdischen Vorstandsmitglieder (Eitingon u.a.) auf Druck – diese emigrierten kurz darauf. 1935 wurden alle übrigen jüdischen Mitglieder aufgefordert aus der DPG auszutreten; einige nichtjüdische Analytiker (etwa Bernhard Kamm) protestierten und gingen ins Exil. Die verbliebenen „arischen“ Therapeuten integrierten sich 1936 in das von der NS-Diktatur neu gegründete „Deutsche Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie“ unter Leitung von Matthias Heinrich Göring, einem Vetter Hermann Görings. Dieses sogenannte Göring-Institut sollte eine nazikonforme Psychotherapie entwickeln und ersetzte die verbotene Freudsche Psychoanalyse durch „Tiefenpsychologie“, bereinigt von jüdischen Einflüssen. Die DPG selbst wurde 1938 aufgelöst. Viele bedeutende Psychoanalytiker emigrierten in dieser Zeit (Freud 1938 nach London, wo er 1939 starb; Ferenczi starb 1933, Jung hatte sich bereits getrennt). Trotz Anpassungsversuchen wurde die klassische Psychoanalyse im NS-Staat marginalisiert oder ins Exil gedrängt. Einige Therapeuten (z.B. Felix Boehm, Carl Müller-Braunschweig) versuchten, im Rahmen des Göring-Instituts eine Rest-Kontinuität der Tiefenpsychologie zu bewahren, was nach 1945 zu kontroversen Bewertungen führte.
Nach 1945 musste die Psychoanalyse in Deutschland praktisch neu aufgebaut werden, da viele Fachleute emigriert oder durch Krieg und Holocaust ums Leben gekommen waren. In den Westzonen förderten die Alliierten anfangs psychotherapeutische Angebote, u.a. übernahmen örtliche Gesundheitsbehörden bestehende Einrichtungen. So wurde 1946 in Berlin das frühere NS-Institut als „Zentralinstitut für psychogene Erkrankungen“ unter Trägerschaft der städtischen Versicherung wiedereröffnet – erstmals konnten dort psychotherapeutische Behandlungen in begrenztem Umfang auf Krankenschein erfolgen. Auch in München genehmigte die US-Militärregierung 1946 ein Institut für Psychotherapie als Nachfolger des Göring-Instituts. Entscheidend für den Neuanfang war Alexander Mitscherlich, der 1949 die erste psychosomatische Klinik in Heidelberg gründete und 1960 in Frankfurt das Sigmund-Freud-Institut (SFI) mitbegründete. Mitscherlich prägte die Nachkriegs-Psychoanalyse durch die Verbindung von Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. Sein bekanntestes Werk „Die Unfähigkeit zu trauern“ (1967, mit Margarete Mitscherlich) analysierte die Verdrängung der NS-Vergangenheit in der deutschen Nachkriegsgesellschaft und wurde zum geistigen Wendepunkt. Institutionell konstituierten sich zwei Fachgesellschaften: die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV) 1950 (als neuer deutscher Zweig der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, IPA) und die Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG) 1945/51 wieder. Die DPV bestand vornehmlich aus rückgekehrten Emigranten oder im Ausland ausgebildeten Analytikern, während die DPG aus dem in Deutschland verbliebenen Kreis (teils vom Göring-Institut kommend) hervorging. Anfangs gab es Spannungen zwischen diesen Gruppen, doch beide Gesellschaften entwickelten sich zu tragenden Säulen der Ausbildung. In den 1950/60er-Jahren entstand zudem die DGPT (1967 gegründet als Dachverband), welche Ärzte und Psychologen in psychoanalytischer Ausbildung vereinte. Insgesamt erholte sich die Psychoanalyse in Westdeutschland bemerkenswert: In vielen Großstädten etablierten sich Ausbildungsinstitute, und Kliniken für Psychosomatik/Psychotherapie (etwa in Stuttgart, München, Aachen) wurden von Psychoanalytikern geleitet. In der DDR hingegen war klassische Psychoanalyse ideologisch weniger akzeptiert und wurde weitgehend durch andere Ansätze (Pawlow’sche Reflexologie, später humanistische Psychologie) ersetzt; erst gegen Ende der DDR flossen psychoanalytische Konzepte dort stärker ein.
Ab den 1960er-Jahren wurden in Deutschland zunehmend internationale Weiterentwicklungen der Psychoanalyse rezipiert. Während die heimische Nachkriegspsychoanalyse lange der klassischen Freud’schen Lehre folgte, drängten nun neue Theorien herein: In den 1970er-Jahren fanden die Narzissmus-Theorien von Heinz Kohut und Otto Kernberg (entwickelt in den USA) Interesse. Auch die britische Objektbeziehungstheorie (Melanie Klein, Donald Winnicott) und Gruppentherapie-Konzepte beeinflussten die deutsche Szene. Freuds Tochter Anna Freud und ihre Ich-Psychologie-Schule sowie Bindungstheorie (John Bowlby) gewannen in der Kinderanalyse an Bedeutung. Zwar blieb die Lacan’sche Psychoanalyse in Deutschland eine Randerscheinung (im Gegensatz zu Frankreich), doch es gab vereinzelt Lacan-Lektüregruppen in den 1970ern. Die Studierendenbewegung um 1968 brachte ebenfalls frischen Wind: Freud und insbesondere der unorthodoxe Wilhelm Reich wurden von der politisch linken Studentenbewegung wieder entdeckt. In dieser Zeit entstand ein kritisch-marxistischer Blick auf Psychoanalyse (Stichwort Frankfurter Schule: z.B. Erich Fromm, Herbert Marcuse), der in Deutschland viel diskutiert wurde. Eine weitere Schule war die Neopsychoanalyse bzw. Kulturpsychoanalyse (Karen Horney, Harry Stack Sullivan), die den Einfluss kultureller und zwischenmenschlicher Faktoren betonte – ihre Vertreter wirkten zwar hauptsächlich in den USA, beeinflussten aber auch deutsche Therapeuten. In den 1980er und 90er Jahren holte die deutsche Psychoanalyse schließlich fast alle internationalen Entwicklungen nach: Selbstpsychologie, Intersubjektivismus und psychodynamische Familientherapie wurden integriert. Ab den 1990er-Jahren begann zudem eine verstärkte Aufarbeitung der eigenen Geschichte: Deutsche Analytiker setzten sich kritisch mit der Rolle ihrer Vorgänger im Nationalsozialismus auseinander, was teils zu späten Ehrenerklärungen für die ausgeschlossenen jüdischen Mitglieder führte. Insgesamt existiert heute kein monolithisches „Freud-Schule“ mehr, sondern eine pluralistische Landschaft psychoanalytischer Schulen in Deutschland: Freudianer (klassische Triebtheorie) stehen neben Jungianern (Analytische Psychologie hat eigene Institute), Individualpsychologen (Adlerianer, auch mit eigenen Vereinen), objektbeziehungstheoretisch oder self-psychologisch orientierten Analytikern sowie neueren relationalen Ansätzen. Dieser Pluralismus wird durch Dachverbände (DGPT, DPV, DPG, VAKJP für Kinderanalyse etc.) koordiniert.
Psychoanalyse in der akademischen Landschaft
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts fand die Psychoanalyse kaum Eingang in die akademische Psychologie, die überwiegend von experimenteller Psychologie und Behaviorismus geprägt war. Freud selbst hatte keine akademische Professur inne, und auch nach 1945 blieb die universitäre Psychologie in Deutschland eher distanziert gegenüber der Psychoanalyse. Stattdessen wurde die Psychoanalyse bis in die 1960er-Jahre vor allem außerhalb der Universitäten gelehrt – in privaten Instituten, oft unter ärztlicher Trägerschaft. Eine gewisse Ausnahme bildete das Fach Psychosomatische Medizin in der Medizinischen Fakultät: Hier erhielt Alexander Mitscherlich 1950 in Heidelberg einen Lehrauftrag bzw. später eine Professur und konnte psychoanalytische Konzepte in Lehre und Krankenversorgung etablieren. Später entstand 1970 an der Universität Frankfurt erstmals eine Professur für Psychoanalyse im Fachbereich Psychologie (ebenfalls initiiert durch Mitscherlichs Wirken am SFI). Auch einzelne weitere Universitäten (z.B. Hamburg, Ulm) richteten vorübergehend Lehrstühle oder Abteilungen mit psychoanalytischem Schwerpunkt ein.
Seit den 1980er-Jahren jedoch ist ein fortschreitender Rückgang psychoanalytischer Lehrstühle zu beobachten. Aus der akademischen Psychologie wurde die Psychoanalyse nach und nach immer mehr verdrängt. In den letzten Jahren kam es etwa an der Goethe-Universität Frankfurt – einst eine Hochburg durch Mitscherlich und später Tilmann Habermas – zur Streichung der eigenständigen Professur: Nach der Pensionierung von Prof. Habermas 2022 wurde beschlossen, keine Nachfolge im Fach Psychoanalyse auszuschreiben. Stattdessen konzentriert man sich auf Klinische Psychologie mit verhaltenswissenschaftlichen Schwerpunkten. Psychoanalytiker beklagen, ihr Fach werde an den Hochschulen an den Rand gedrängt. Tatsächlich sind nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) von 61 universitären Lehrstühlen für Klinische Psychologie heute 60 verhaltenstherapeutisch orientiert, nur 1 ist noch anders ausgerichtet – ein deutliches Ungleichgewicht. Studierende der Psychologie kommen daher während des Studiums oft kaum noch mit psychoanalytischer Theorie oder Praxis in Berührung. Damit fehlt an den Universitäten eine Generation von Lehrenden und Forschern, welche die Tiefenpsychologie vertreten könnten. Dieser Aderlass wird von Fachleuten als kultureller Verlust gesehen: Mit dem Frankfurter Lehrstuhl verschwindet eine der letzten Möglichkeiten, psychoanalytische Theorie innerhalb der Universität kennenzulernen. Allerdings gibt es auch gegenläufige Bemühungen: 2025 konnte die Uni Frankfurt, unterstützt von privaten Stiftungen, wieder eine Professur für Klinische Psychoanalyse einrichten, um die traditionsreiche Frankfurter psychoanalytische Forschung fortzuführen. Diese neue Stiftungsprofessur, gekoppelt an das Sigmund-Freud-Institut, soll helfen, psychoanalytische Ansätze in Forschung und Lehre präsent zu halten – ein Modell, das künftig Schule machen könnte.
Wissenschaftstheoretische Debatten
Die Stellung der Psychoanalyse an den Hochschulen war immer auch durch die Frage nach ihrer Wissenschaftlichkeit geprägt. In den 1950/60er-Jahren entbrannte eine lebhafte Debatte mit Philosophen und Psychologen: Karl Popper, führender Wissenschaftstheoretiker, bezeichnete die Psychoanalyse früh als Pseudowissenschaft, da ihre Theorien nicht falsifizierbar seien. Er stellte sie in eine Reihe mit Astrologie und Marxismus als Beispiele für Lehren, die immer recht behalten wollen, indem sie ihre Annahmen an jede Beobachtung anpassen. Dieser Vorwurf traf die Psychoanalyse im Mark, denn er sprach ihr den Status als empirische Wissenschaft ab. In der Folge verteidigten einige Philosophen die Psychoanalyse auf anderen Wegen: Jürgen Habermas argumentierte 1968 in „Erkenntnis und Interesse“, die Psychoanalyse sei weniger eine Naturwissenschaft als eine Geistes- und Sozialwissenschaft. Sie verbinde empirische Beobachtung mit methodischer Selbstreflexion und habe ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse. Habermas sah sie als „einzig greifbares Beispiel einer Wissenschaft, die methodische Selbstreflexion einbezieht“. Zwar habe Freud selbst versucht, seine Theorie im naturwissenschaftlichen Gewand zu präsentieren, doch eigentlich überschreite die Psychoanalyse den Positivismus und gehöre in den Bereich der interpretativen Wissenschaften. Auch Paul Ricœur (1965) interpretierte Freud eher hermeneutisch als „Meister der Auslegung“. Dennoch blieb die Kritik bestehen: In den 1980ern formulierte der Philosoph Adolf Grünbaum eine umfassende kritische Analyse Freuds. In „The Foundations of Psychoanalysis“ (1984, dt. 1991) bestritt Grünbaum, dass die klinischen Daten der Psychoanalyse zur Beweisführung ihrer Theorien ausreichen. Er setzte sich kritisch mit Habermas und Ricœur auseinander und versuchte zu zeigen, dass Freud keine empirisch-validen Bestätigungsstrategien hatte. Grünbaum kam – pointiert gesagt – zum Schluss, dass viele psychoanalytische Hypothesen nicht belegt seien und die von Freud behauptete universelle Gültigkeit seiner Deutungen unbegründet ist. Diese Debatten haben das Selbstverständnis der Disziplin nachhaltig beeinflusst: Ab den 1970ern entwickelten einige Psychoanalytiker ein stärker empirisches Forschungsinteresse, während andere betonten, Psychoanalyse bewege sich in einem anderen Erkenntnisparadigma (tiefenhermeneutisch statt experimentell). Zugleich hat die Kritik den akademischen Status beeinträchtigt – viele Psychologie-Institute scheuten sich, eine als „unwissenschaftlich“ geltende Lehre hochzuhalten. Bis heute wird in Lehrbüchern der Psychologie häufig auf Poppers Kritik verwiesen, während Habermas’ differenziertere Sicht nur am Rande vorkommt.
In der heutigen universitären Ausbildung spielt Psychoanalyse in der Regel eine untergeordnete Rolle. Die meisten Psychologie-Bachelor- und Masterstudiengänge in Deutschland behandeln psychodynamische Theorien nur am Rande (z.B. in Überblicksvorlesungen zur Klinischen Psychologie) oder optional in Wahlfächern. Der Schwerpunkt liegt stark auf der Verhaltenstherapie. Dies spiegelt sich auch in der personellen Zusammensetzung wider (siehe oben: 60 von 61 Lehrstühlen verhaltenstherapeutisch orientiert). Folge: Viele Absolventen kennen die Psychoanalyse nur aus der Theoriegeschichte, nicht aber als lebendigen Bestandteil klinischer Praxis. Insgesamt jedoch dominiert die Kognitions- und Neurowissenschaft im Psychologiestudium, sodass Psychoanalyse eher in benachbarten Fächern (z.B. Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaft oder Philosophie) als Diskurs präsent bleibt. In der Medizinerausbildung ist die Lage etwas besser: Im Fach Psychosomatik/Psychotherapie lernen angehende Ärzte zumindest Grundlagen der tiefenpsychologisch fundierten Gesprächsführung, und einige Universitätskliniken (etwa für Psychiatrie oder psychosomatische Medizin) haben noch psychoanalytisch orientierte Oberärzte oder Lehrtherapeuten. Allerdings wurde auch hier der Curriculumdruck erhöht, mehr verhaltensnahe und pharmakologische Inhalte zu lehren.
Einfluss neuer Ausbildungsstrukturen
Die jüngste Reform des Psychotherapeutenausbildungsgesetzes wirkt sich ebenfalls auf die akademische Landschaft aus. Zum einen schreibt sie vor, dass Studierende künftig alle wissenschaftlich anerkannten Therapieansätze kennenlernen sollen. In der Theorie könnte dies der Psychoanalyse Raum verschaffen. Die Realität sieht jedoch kritischer aus: Psychoanalytische Verbände befürchten, dass die Universitäten mangels entsprechender Dozenten vor allem die Verhaltenstherapie lehren und die Tiefenpsychologie weiter zurückgedrängt wird. DGPT-Vorsitzender Georg Schäfer kritisierte 2020, der Entwurf der Approbationsordnung werde dem Missstand einer einseitig verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Lehre nicht abhelfen. Es fehlten verbindliche Vorgaben, alle Richtlinienverfahren (also auch Analytische und Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) im Studium durch entsprechend qualifizierte Dozenten zu vermitteln. Tatsächlich lernen, wie erwähnt, die meisten Psychologiestudierenden derzeit nur VT praktisch kennen. Konfliktlinien entstehen hier zwischen Universitäten und den traditionsreichen außeruniversitären Instituten: Letztere haben seit Jahrzehnten die psychoanalytische Ausbildung übernommen. Mit der Reform droht ihnen der Nachwuchs auszugehen, wenn die Uniabsolventen sich gar nicht erst für Psychoanalyse interessieren. Zudem ist unklar, wie die Institute in die neue Weiterbildungsstruktur eingebunden werden. Andererseits ergeben sich Chancen, dass psychoanalytische Inhalte nun innerhalb der Hochschulen (im neuen Master Psychotherapie) gelehrt werden müssen, was ihren Kenntnisstand verbreitern könnte. Einige Universitäten nutzen ihre Gestaltungsmöglichkeiten, um psychoanalytische Lehre zu retten – wie Frankfurt mit der erwähnten Stiftungsprofessur. Insgesamt bleibt aber festzuhalten: Akademisch fristet die Psychoanalyse derzeit ein Nischendasein. Kritik an ihrer Wissenschaftlichkeit und der Trend zur Neuro- und Kognitionswissenschaft haben sie aus den Curricula weitgehend verdrängt. Versuche, den „Geruch der Unwissenschaftlichkeit“ loszuwerden und sich dem positivistischen Wissenschaftsbetrieb anzupassen, hatten bislang nur begrenzten Erfolg. Einige Psychoanalytiker plädieren daher dafür, offensiv die Eigenständigkeit der Psychoanalyse zu betonen – als kritisch-hermeneutische Wissenschaft vom Subjekt, die sich nicht vollständig in empirische Randomisiertstudien pressen lässt. Dieses Spannungsfeld zwischen Anpassung an akademische Standards und Bewahrung eines eigenständigen Profils prägt das Selbstverständnis der Disziplin bis heute.
Einbindung in das Kassensystem
Die Einbindung psychoanalytischer Psychotherapie in das deutsche Gesundheitssystem vollzog sich schrittweise im Laufe des 20. Jahrhunderts. Bereits in der Weimarer Republik gab es erste Ansätze, psychoanalytische Behandlungen öffentlich zugänglich zu machen (z.B. über die Berliner Poliklinik ab 1920). Während der NS-Zeit wurden – nach anfänglicher Ächtung – gewisse psychotherapeutische Leistungen über das Göring-Institut und die Versicherungsanstalt Berlin (VAB) ermöglicht: Ab 1941/42 konnten dort in begrenztem Umfang Behandlungen auf Kosten der VAB durchgeführt werden, was eine frühe Form der Kassenleistung darstellte. Nach 1945, in der jungen Bundesrepublik, war Psychotherapie zunächst Sache der Ärzte (Nervenärzte, Psychiater, Psychosomatiker). Psychoanalytiker, die Arzt waren, konnten ihre Leistungen als Krankenbehandlung im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung abrechnen, jedoch ohne einheitliche Regelung. Psychologen hingegen hatten bis in die 1980er-Jahre keinen direkten Zugang zur Kassenabrechnung – sie durften nur in Ausnahmefällen über Umwege (Delegationsverfahren) tätig werden. Ein Meilenstein war 1967, als die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Krankenkassen gemeinsam die ersten Psychotherapie-Richtlinien verabschiedeten. Diese Richtlinien definierten, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang Psychotherapie zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erbracht werden darf. In der ersten Fassung von 1967 wurden vor allem die psychoanalytisch begründeten Verfahren berücksichtigt, da Verhaltenstherapie damals in Deutschland noch weniger verbreitet war. Ab 1970/71 galten Analytische Psychotherapie (im Liegen, hochfrequent, oft 2–3 Jahre Dauer) und Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (modifizierte Form, 1x/Woche, kürzer) offiziell als kassenärztliche Leistungen. Damit war die Psychoanalyse institutionalisiert: Patienten konnten eine Therapie beantragen, die von der Krankenkasse bezahlt wurde, sofern ein Gutachter (externer Facharzt) die Indikation bestätigte (das sogenannte Gutachterverfahren wurde gleichzeitig eingeführt. Diese Anerkennung machte Deutschland international zu einem Sonderfall – in kaum einem anderen Land war klassische Psychoanalyse Teil des öffentlichen Gesundheitswesens. In den folgenden Jahrzehnten stellte die GKV Mittel für tausende psychoanalytische Behandlungen bereit. 1985 wurden dann auch Verhaltenstherapie und später (2006) Gesprächstherapie nach Rogers als Kassenverfahren aufgenommen, doch letztere flog 2018 wieder raus (mangelnder Evidenznachweis). Seit 2020 ist zudem Systemische Therapie für Erwachsene kassenfähig. Somit gibt es derzeit vier anerkannte „Richtlinienverfahren“: Analytische Psychotherapie, Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie (jeweils für Erwachsene und Kinder/Jugendliche) sowie Systemische Therapie (zunächst nur Erwachsene). Die psychoanalytischen Verfahren behaupteten also über Jahrzehnte ihren Platz im GKV-System – eine Besonderheit, die auf die frühzeitige Integration in den 1960ern zurückgeht.
Rolle von G-BA und Wissenschaftlichem Beirat Psychotherapie
Mit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes 1999 kam es zu einer Neuordnung der Zuständigkeiten. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) – das oberste Entscheidungsorgan der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen – ist seitdem dafür zuständig, die Psychotherapie-Richtlinie zu erlassen und fortzuschreiben. Der G-BA entscheidet, welche Therapieverfahren „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ sind (§92 SGB V) und somit von der Kasse bezahlt werden dürfen. Für die wissenschaftliche Bewertung wurde parallel der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie (WBP) eingerichtet. Dieses Gremium aus Experten (berufen von Bundesärztekammer und Bundespsychotherapeutenkammer) hat die Aufgabe, die Wirksamkeitsnachweise neuer Therapieverfahren zu prüfen. Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte Therapie genossen zum Zeitpunkt des PsychThG-Inkrafttretens faktisch Bestandschutz – als vom Bundesausschuss bereits anerkannte Verfahren waren sie von einer nochmaligen Überprüfung ausgenommen. Gleichwohl unterzogen DPV, DPG und DGPT ihre Methoden einer freiwilligen Evaluation durch den WBP, um den aktuellen Wissenschaftsstand zu dokumentieren. In seiner Stellungnahme 2004 bestätigte der WBP die wissenschaftliche Anerkennung der Psychodynamischen Psychotherapie für eine Vielzahl von Indikationsbereichen (u.a. affektive Störungen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen). Er betonte dabei, dass die Unterscheidung zwischen „analytisch“ und „tiefenpsychologisch“ wissenschaftlich nicht begründbar sei – es handele sich um dasselbe Verfahren mit nur sozialrechtlich unterschiedlicher Ausprägung. Folgerichtig verwendet der WBP seither den Oberbegriff „Psychodynamische Psychotherapie (PP)“ für beide Settings. Interessant sind einige Zahlen aus der WBP-Stellungnahme: Psychodynamische Therapien seien „seit 1967 Pflichtleistung der GKV“ und machten seit Jahrzehnten einen wesentlichen Teil der Versorgung aus. So würden ambulant zwischen 50 und 65 % aller Psychotherapien in Deutschland psychodynamisch durchgeführt, im stationären Bereich vermutlich ähnlich viele. Diese offiziellen Feststellungen unterstreichen die historische Dominanz der psychoanalytisch begründeten Verfahren in der Versorgung. – Der G-BA selbst hat die Richtlinie über die Jahre mehrfach angepasst, z.B. die maximale Stundenzahl reguliert. Aktuell dürfen Analytische Psychotherapien bis zu 300 Sitzungen (plus Verlängerung in Ausnahmefällen) umfassen, tiefenpsychologische Therapien bis 100 (plus Verlängerung). Für solche Langzeittherapien ist weiterhin ein anonymisiertes Gutachterverfahren nötig, das die Kasse vor Bewilligung einholt. Der G-BA prüft in mehrjährigen Abständen auch, ob neue empirische Evidenz Änderungen erfordert. Zuletzt (2018) wurde aufgrund neuer Evidenz die Systemische Therapie aufgenommen, während z.B. die Gesprächspsychotherapie trotz einiger Wirksamkeitsnachweise nicht aufgenommen wurde (weil der WBP hier keine ausreichende Wirksamkeit für alle Indikationen sah). Im Falle der psychoanalytischen Verfahren besteht derzeit kein Zweifel an deren Anerkennung: Sie gelten als bewährte Verfahren für eine Reihe von Störungsbildern, was durch Meta-Analysen und Studien untermauert wird. Allerdings stehen sie im Wettbewerb mit kostengünstigeren bzw. kürzeren Ansätzen, was in G-BA-Diskussionen über Wirtschaftlichkeit immer wieder Thema ist.
Finanzierung und Beantragung – aktuelle Herausforderungen
In der praktischen Umsetzung stoßen Psychoanalytiker in der Versorgung heute auf einige Herausforderungen. Zum einen sind da die Beanachtungsverfahren und Gutachten: Wer als Patient eine Langzeit-Psychoanalyse (z.B. 3x/Woche) beginnen möchte, muss einen vergleichsweise aufwendigen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Der Therapeut verfasst einen anonymisierten Bericht mit Diagnostik und Behandlungsplan, der von einem externen Gutachter (selbst erfahrener Psychotherapeut) geprüft wird. Kritiker monieren, dass diese Hürde höher ist als bei kürzeren Verfahren und mitunter dazu führt, dass Anträge für sehr lange Behandlungen skeptischer begutachtet werden (Stichwort: Kostendämpfung). Dennoch werden die meisten Anträge genehmigt, sofern eine entsprechende Indikation (schwere chronifizierte Störung, strukturelle Probleme etc.) dargelegt wird. Ein zweiter Punkt ist die Manualisierung: In den letzten Jahren fordern Kostenträger und Wissenschaft vermehrt manualisierte und störungsspezifische Therapien, um Vergleichbarkeit und Qualität zu gewährleisten. Die klassische Psychoanalyse war jedoch traditionsgemäß wenig manualisiert – sie lebt von der freien Assoziation und dem individuellen Vorgehen. Langjährige Analysen unterscheiden sich stark von manualbasierten Kurzzeittherapien. Forscher weisen darauf hin, dass es nahezu unmöglich ist, eine psychodynamische Langzeittherapie strikt zu manualisieren oder in randomisierten Studien nach Goldstandard zu prüfen. Über Jahre laufende Prozesse lassen sich kaum mit Kontrollbedingungen versehen; Versuche, Patienten per Los entweder einer langen Analyse oder einer anderen Behandlung zuzuweisen, scheitern oft an der Unmöglichkeiten, Patient*innen zu randomisieren. Daher sind RCTs (randomisiert-kontrollierte Studien) für klassische Analysen selten. Stattdessen nutzt man zumeist naturalistische Studien und Prä-Post-Vergleiche. Diese Methoden sind akzeptiert, doch in der evidenzorientierten Gesundheitspolitik zählen RCTs am höchsten. Insofern steht die Psychoanalyse vor der Aufgabe, ihre Wirksamkeit unter modernen Evidenzkriterien darzustellen, ohne ihre Therapeutik komplett zu verbiegen. Erste Schritte zu mehr Standardisierung wurden getan: Es gibt manualisierte Kurzzeit-psychodynamische Therapien (z.B. die Dynamische Psychotherapie nach Luborsky für bestimmte Störungen) und strukturierte Ansätze wie MBT (Mentalisierungsbasierte Therapie) oder TFP (Übertragungsfokussierte Therapie) für Persönlichkeitsstörungen. Diese sind psychoanalytisch fundiert, aber manualisiert – und konnten in Studien Wirksamkeit zeigen. Solche Ansätze helfen, psychoanalytische Therapie „kassenfest“ zu halten, indem sie die Anschlussfähigkeit an Leitlinien und Diagnosemanuale (ICD/DSM) gewährleisten.
Weitere Herausforderungen im Kassensystem sind Wartezeiten und Kapazitäten: Es gibt vielerorts mehr Nachfrage nach kassengestützter Psychotherapie (egal welcher Schule) als Angebot. Psychoanalytische Therapeuten – die oft viele Stunden pro Patient investieren – können pro Jahr nur wenige Patienten neu aufnehmen. Dies führt zu monatelangen Wartezeiten, was seitens Politik und Kassen kritisiert wird. Um dem zu begegnen, setzen manche Psychoanalytiker inzwischen auch vermehrt auf Kombinationsbehandlungen (z.B. erst einen tiefenpsychologischen Kurzzeitabschnitt, dann Überleitung in eine längere Analyse bei Indikation) oder gruppenanalytische Ansätze, um mehr Patienten zu erreichen. Manualisierung wird auch hier zum Thema: In Richtlinien und Qualitätssicherung wird gefordert, dass Therapien transparent strukturiert sind. Die Psychoanalyse hat darauf reagiert, z.B. durch das Instrument der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD), das in Berichten eine standardisierte Darstellung der unbewussten Konflikte und Strukturniveaus ermöglicht. Insgesamt steht die psychoanalytische Psychotherapie heute unter dem Druck, Effizienz und Evidenz nachzuweisen, um ihren Platz im Solidarsystem zu behaupten. Ihre Stärke bleibt jedoch die Langzeitwirkung und Tiefe der Veränderung: Studien zeigen, dass lange Therapien oft nachhaltige Verbesserungen bringen und mittelfristig sogar Kosten im Gesundheitssystem sparen (weniger Krankschreibungen, Arztbesuche). Dieses Argument wird genutzt, um die Finanzierung auch zeitintensiver Verfahren zu rechtfertigen.
Forschungslage: Wirksamkeit und Prozessforschung
Von Einzelfallstudien zur Evidenzbasierung
Die psychoanalytische Forschung hat sich im Lauf des letzten Jahrhunderts stark gewandelt. Frühere Generationen – beginnend bei Freud – stützten sich vor allem auf Einzelfalldarstellungen. Freuds berühmte Fälle (etwa „Dora“ oder „Der kleine Hans“) sollten die Theorie illustrieren, waren aber keine systematischen Studien. Bis in die 1970er wurden Fortschritte der Psychoanalyse hauptsächlich durch konzeptuelle Arbeiten und Kasuistiken erzielt. Kritik an der mangelnden empirischen Überprüfbarkeit (siehe Popper) führte ab den 1980ern zu verstärkten Bemühungen, psychoanalytische Therapien nach wissenschaftlichen Standards zu untersuchen. Inzwischen liegt eine große Zahl empirischer Studien und Meta-Analysen vor, welche die Wirksamkeit psychodynamischer Psychotherapien belegen. Der Wissenschaftliche Beirat kam 2004 zum Ergebnis, dass die Wirksamkeitsnachweise für Psychodynamische Psychotherapie in allen relevanten Störungsbereichen erbracht sind. International sorgten Arbeiten wie die Meta-Analyse von Leichsenring & Rabung (2008) für Aufmerksamkeit, die für Langzeit-Psychotherapie (über 1 Jahr) große Effektstärken fand (d ~ 0,8). Übersichtsarbeiten zeigen konsistent, dass psychodynamische Verfahren insgesamt wirksam sind. Beispielsweise fasste Shedler (2010) verschiedene Meta-Analysen zusammen und berichtete, dass die Effektstärken psychodynamischer Therapien vergleichbar seien mit denen anderer evidenzbasierter Verfahren und dass die erzielten Verbesserungen oft noch nach Therapieende weiter zunähmen (ein „Schneeballeffekt“ durch langfristige Einsichtsprozesse). Eine Meta-Analyse von Diener, Hilsenroth & Weinberger (2007) fand ebenfalls deutliche Verbesserungen bei behandelten Patienten im Vergleich zu unbehandelten oder Placebogruppen. Für spezifische Störungen liegen etliche randomisierte Studien vor. Nicht zuletzt zeigte sich in Katamnese-Studien, dass psychoanalytisch behandelte Patienten im Anschluss deutlich weniger medizinische Leistungen in Anspruch nahmen (weniger Hausarztbesuche, weniger Krankschreibungen) – ein indirekter Hinweis auf die gesundheitökonomische Bedeutung. Neuere zusammenfassende Arbeiten (etwa von Jessica Yakeley und Peter Hobson, 2015 für die British Psychoanalytic Society) belegen positive Wirkungen psychodynamischer Therapien bei verschiedenen psychischen Störungen. Einige Meta-Analysen deuten an, dass die Effektstärken mit längerer Behandlungsdauer sogar zunehmen – besonders bei komplexen Störungen, wo kurze Therapien oft nicht genügen
Prozessforschung – was wirkt in der Therapie?
Über die Frage „Ist Psychoanalyse wirksam?“ hinaus interessiert die Forschung zunehmend das „Wie?“: Welche Prozesse und Mechanismen führen zu Veränderungen? Hier hat die Psychoanalyse selbst viele Konzepte geliefert (Übertragungsdurcharbeitung, Einsicht, etc.), und die moderne Prozessforschung versucht, diese zu objektivieren. Ein wichtiger Schritt war die Entwicklung der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD) in den 1990er-Jahren. Die OPD ist ein multiaxiales Diagnosesystem, das psychoanalytische Kernkonzepte messbar machen soll. Auf Achsen wie „Konflikt“ oder „Strukturniveau“ können Therapeuten den Patienten einschätzen. Ein standardisiertes OPD-Interview ermöglicht es, unbewusste Konfliktthemen, Beziehungsmuster und Ich-Funktionen systematisch zu erfassen. Studien haben gezeigt, dass OPD-Achsen gute Reliabilität erreichen und z.B. prädiktiv für den Therapieverlauf sein können – etwa: Patienten mit bestimmter Konfliktdynamik profitieren eher von bestimmten Interventionen. Die OPD hat sich auch in der Praxis verbreitet (z.B. in Berichten an Gutachter). Darüber hinaus untersucht man spezifische Therapieprozesse: z.B. die Rolle der therapeutischen Allianz, von Übertragungsdeutungen, von Emotionsfokussierung usw. Empirische Studien – etwa Videoanalysen von Therapiesitzungen – zeigten, dass Übertragungsdeutungen unterschiedlich wirken je nach Patiententyp: Bei höher strukturierten Patienten können sie tiefe Einsichten fördern und den Therapieerfolg steigern, bei sehr fragilen Patienten dagegen überfordern sie mitunter, sodass hier eine zurückhaltendere, stützendere Technik hilfreicher ist. Solche Befunde tragen dazu bei, Therapie differenzialindiziert zu gestalten (wer braucht intensives Deuten, wer mehr Halt und Support?).
Ein weiterer Strang ist die Bindungsforschung: Auf Grundlage der Bindungstheorie untersucht man, wie die frühkindlichen Beziehungsmuster eines Patienten (etwa unsicher-vermeidend vs. unsicher-ambivalent) den Therapieverlauf beeinflussen. Patienten mit unsicherer Bindung zeigen oft größere Schwankungen in der therapeutischen Beziehung; hier ist besondere Stabilisierung nötig. Gleichzeitig kann erfolgreiche Psychotherapie das Bindungsmuster eines Patienten „sicherer“ machen – dies wurde in Längsschnittuntersuchungen mit Erwachsenen festgestellt, die nach langer Analyse im Adult Attachment Interview sicherer eingestuft wurden. Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse werden ebenfalls empirisch erforscht: Therapeuten füllen z.B. nach Sitzungen Fragebögen aus, wie sie die Beziehung erlebten, um typische Gegenübertragungsthemen zu identifizieren. So fand man etwa, dass Patienten mit bestimmter Persönlichkeitsstruktur wiederholt ähnliche Gefühle im Therapeuten auslösen (z.B. Hilflosigkeit bei borderline, Langeweile bei depressiven Neurosen) – ein quantitativer Zugang zu einem klassischen Konzept. Die Neuropsychoanalyse schließlich versucht, die Brücke zur Neurowissenschaft zu schlagen. Forscher wie Mark Solms untersuchen neuronale Korrelate von psychoanalytischen Phänomenen. So gibt es fMRI-Studien, in denen gezeigt wird, dass introspektives Denken über eigene Konflikte bestimmte Hirnareale aktiviert, oder dass Traumverarbeitung mit limbischen Aktivitätsmustern korreliert, was Freuds Annahmen über Traum und Emotion teilweise stützt. Die Neuropsychoanalyse beruft sich darauf, dass Freud selbst Neurologe war und eine „naturwissenschaftliche Psychologie“ schaffen wollte. Es wurden internationale Kongresse und Zeitschriften (z.B. Neuro-Psychoanalysis) ins Leben gerufen, um den Dialog zwischen Psychoanalytikern und Hirnforschern zu fördern. Manche psychoanalytischen Theoretiker stehen dem auch kritisch gegenüber – sie befürchten eine Simplifizierung der komplexen seelischen Vorgänge. Nichtsdestotrotz hat diese Forschung interessante Ergebnisse hervorgebracht, etwa zur Rolle des impliziten Gedächtnisses: Neuropsychologische Experimente zeigen, dass Menschen unbewusste Erinnerungen (z.B. durch frühkindliche Prägung) in ihrem Verhalten zeigen, was als eine Bestätigung des Freudschen Unbewussten interpretiert werden kann – nun mit dem Vokabular der impliziten Gedächtnisforschung.
Allgemeine vs. spezifische Wirkfaktoren
In der Psychotherapieforschung gibt es seit langem die Debatte, ob die Wirksamkeit vor allem von allgemeinen Faktoren (z.B. Empathie, Vertrauen, Hoffnung, therapeutische Beziehung) oder von spezifischen Techniken der jeweiligen Schule abhängt. Meta-Analysen deuten darauf hin, dass ein großer Teil (viele sagen ~70%) des Therapieerfolgs auf schulenübergreifende allgemeine Faktoren zurückgeht. Eine einflussreiche Darstellung von Bruce Wampold zeigt z.B., dass spezifische Techniken nur etwa 8% Varianz erklären, während Faktoren wie Allianz, Emotionen, gemeinsame Problembewältigung viel wichtiger sind. Für die Psychoanalyse bedeutet das: Auch hier wirken zunächst unspezifische Aspekte – die stabile langandauernde Beziehung, die Aufmerksamkeit des Therapeuten, das Setting, das dem Patienten Raum gibt. Allerdings betonen Psychoanalytiker, dass ohne die spezifischen Methoden (wie Deutung des Unbewussten, Durcharbeiten von Widerstand und Übertragung) die tiefgreifenden Veränderungen nicht stattfinden. Die Debatte ist nicht entschieden. Empirie zeigt, dass therapeutische Allianz ein sehr starker Prädiktor für Outcome ist – was für alle Therapieformen gilt, auch für die analytische (eine gute Arbeitsbeziehung ermöglicht erst die mutige Exploration schmerzlicher Inhalte). Auf der anderen Seite gibt es Befunde, dass z.B. bei bestimmten Störungen das Arbeiten mit Übertragung einen zusätzlichen Nutzen bringt. So fand eine norwegische Studie (Høglend et al. 2008), dass bei Patienten mit höherem Interaktionsniveau die Verwendung von Übertragungsdeutungen zu besseren Ergebnissen führte, während sie bei weniger strukturierten Patienten keinen Vorteil brachte. Solche differenzierten Resultate legen nahe, dass weder ein reines „Dodo-Bird-Verdict“ (alle Therapiearten gleich wirksam allein durch allgemeine Faktoren) noch ein absoluter Technik-Effekt gilt, sondern eine Wechselwirkung: Die richtigen spezifischen Interventionen zur richtigen Zeit im Kontext einer guten Beziehung führen zum besten Ergebnis. Die Psychoanalyse steuert zu dieser Debatte die lange Erfahrung bei, wie spezifische Interventionen (z.B. Träume deuten, unbewusste Konflikte aufdecken) heilend wirken können – aber sie erkennt ebenso an, dass ohne Wärme, Sicherheit und echtes Engagement keine Heilung stattfinden kann. Die moderne psychodynamische Forschung versucht daher, allgemeine und spezifische Wirkfaktoren zu integrieren: z.B. zu verstehen, wie genau eine Übertragungsdeutung wirkt (über den allgemeinen Faktor Einsicht und das spezifische Moment der früheren Beziehungserfahrung, die aktualisiert wird). So entsteht ein immer klareres Bild davon, wodurch psychoanalytische Therapie Veränderungen bewirkt – und dieses Bild unterscheidet sich gar nicht so fundamental von anderen Therapien (auch in KVT gibt es Einsichtsprozesse und auch in Psychoanalyse ist Empathie zentral). Letztlich profitieren alle Therapieschulen von dieser gemeinsamen Wirkfaktorenforschung.
Status Quo und Selbstverständnis
Psychoanalyse als „unzeitgemäße Wissenschaft“?
Trotz ihrer langen Geschichte sieht sich die Psychoanalyse heute teils als „unzeitgemäß“ diffamiert. Vertreter der modernen empirischen Psychologie (etwa in der Säuglings- und Bindungsforschung) kritisieren, die Psychoanalyse halte an überholten Theorien fest und passe nicht mehr in die Zeit. So wird etwa argumentiert, die Betonung unbewusster Konflikte sei im Zeitalter konkreter neurobiologischer Befunde obsolet. Tatsächlich haben einige neuere Forschungsdisziplinen – z.B. die Entwicklungspsychologie – Befunde erbracht, die gewisse klassische Annahmen Freuds in Frage stellen (etwa dass Kleinkinder primär triebgesteuert seien; heute weiß man, dass schon Säuglinge aktive Beziehungsgestalter sind). Manche Autoren sprechen polemisch von einer „diskreditierten, unzeitgemäßen Wissenschaft“ Psychoanalyse, die im 21. Jahrhundert keinen Platz mehr hätte. Gleichzeitig gibt es auch die Gegenposition: Psychoanalytiker wie Wolfgang Mertens oder Philosophen wie Slavoj Žižek argumentieren dafür, dass gerade in der gegenwärtigen Beschleunigungs- und Oberflächlichkeitstendenz die Psychoanalyse notwendiger denn je sei, um den Blick auf die Tiefe der Psyche und die verborgenen Bedeutungen zu erhalten. Siehe auch der Slogan der DPV, die Freud einmal als „eine unzeitgemäße Betrachtungsweise“ bezeichnete – im Sinne Nietzsches: etwas, das seiner Zeit voraus oder gegen den Zeitgeist gerichtet ist, aber genau dadurch wertvoll. In der Praxis bedeutet dies: Die Psychoanalyse nimmt sich Zeit und Raum für Phänomene (Träume, Kindheitserinnerungen, Fantasien), die im modernen Alltag oft keinen Platz haben. Dieses bewusste „Unzeitgemäße“ verstehen viele Analytiker als Stärke und notwendiges Korrektiv zu einem funktionalistischen Zeitgeist. So betont ein Referententext der Uni Frankfurt die „Unverfügbarkeit“ der Psychoanalyse gegenüber vorschneller Verwertbarkeit und die Bedeutung als kritische Theorie des Subjekts im Kontrast zu einer rein naturwissenschaftlichen Betrachtung. Dennoch muss die Psychoanalyse mit dem Vorwurf leben, nicht auf der Höhe der Zeit zu sein – und sie ringt intern damit, inwieweit sie sich modernisieren soll, ohne ihr Wesen zu verlieren.
Relevanz klassischer Konzepte heute
Viele der klassischen Konzepte Freuds haben auch nach über 100 Jahren nichts von ihrer Bedeutung verloren – sie wurden allerdings weiterentwickelt und teils neu interpretiert. Das Unbewusste etwa ist heute ein fest etablierter Begriff, nicht nur in der Psychoanalyse, sondern auch in Kognitionswissenschaften (Stichwort: implizite Prozesse). Die Idee, dass Menschen motivgesteuerte Handlungen ausführen, ohne sich der Gründe bewusst zu sein, ist durch zahlreiche Experimente bestätigt (z.B. Priming-Effekte). Freuds Konzept der Verdrängung – also dass unangenehme Inhalte dem Bewusstsein ferngehalten werden – findet Entsprechungen im Begriff der Abwehrmechanismen, die empirisch untersucht wurden (George Vaillant und Kollegen entwickelten Skalen zur Messung von Abwehrmechanismen und konnten sie mit psychischer Gesundheit in Verbindung bringen). Andere Konzepte wurden modifiziert: Der klassiche Ödipuskomplex zum Beispiel wird heute weniger streng universell gesehen; moderne Analytiker verstehen ihn eher als Metapher für die Entwicklung der Triangulierung (Kind lernt, die exklusive Dyade zu überwinden und sich in einem Dreiecksverhältnis zu positionieren). Das Konzept ist nach wie vor nützlich, aber wird kulturell differenzierter betrachtet (z.B. gelten Mutter-Vater-Kind-Dynamiken nicht als einziger Weg; in diversen Familienstrukturen kann es Variationen geben). Triebtheorie (Libido- und Aggressionstrieb) war einst das Herzstück bei Freud. Heute steht statt einer biologisch verankerten Triebenergie eher das Beziehungsbedürfnis im Zentrum psychoanalytischer Theorien (intersubjektiver Ansatz). Modelle wie das Strukturmodell (Es-Ich-Überich) werden weiterhin gelehrt, doch es gibt Versuche, sie mit neueren Begriffen (Selbst, objektrepräsentanzen etc.) zu verknüpfen. Summiert kann man sagen: „Die Klassiker leben weiter, aber in verwandelter Form.“ Freud’sche Begriffe dienen als Grundvokabular, doch die praktische Arbeit vieler Analytiker heute unterscheidet sich durchaus von der vor 100 Jahren. Es fließen zum Beispiel objektbezogene Überlegungen ein: Wo Freud frühkindliche Fantasien sexualisierte (Kastraionsangst etc.), betont man nun mehr die realen Beziehungserfahrungen (z.B. frühe Verluste, Traumata). Traumdeutung wird weiterhin praktiziert – Träume gelten nach wie vor als Königsweg zum Unbewussten – aber man bezieht auch neurobiologische Traumforschung ein, was Verständnis über die schlafenden Gehirnvorgänge liefert. Freie Assoziation und gleichschwebende Aufmerksamkeit (die Grundtechnik Freuds) werden in der Langzeittherapie immer noch angewandt; gleichzeitig werden in kürzeren Therapien stärker fokussierte Techniken genutzt. Übertragung und Gegenübertragung bleiben zentrale Werkzeuge: Die aktuelle Beziehung im Therapiezimmer wird genutzt, um alte Muster aufzuzeigen. Dieses Konzept hat sich sogar über die Psychoanalyse hinaus verbreitet – auch in anderen Therapieformen spricht man von der Therapiebeziehung als Wirkfaktor. Ebenso ist „Durcharbeiten“ (working through) immer noch relevant: Der Prozess, einen gewonnenen Einblick mehrfach emotional durchzuleben, um wirklich eine Änderung zu erzielen. Zusammengefasst: Die klassischen Konzepte sind heute noch relevant, allerdings oft eingebettet in einen erweiterten theoretischen Rahmen. Kein moderner Analytiker wird streng an veralteten dogmatischen Ideen (wie z.B. ausschließlich an infantiler Sexualität für jede Neurose) festhalten, sondern es besteht eine Synthese mit neuem Wissen (z.B. Bindungstheorie kombiniert mit Triebtheorie ergibt ein reichhaltigeres Verständnis). Diese Flexibilität zeigt, dass die Psychoanalyse kein erstarrtes Museum ist, sondern eine lebendige Theorie, die sich weiterentwickelt – etwa indem neue Phänomene wie digitale Beziehungen, gesellschaftliche Veränderungen mit ihren Konzepten analysiert werden.
Rolle in stationären und ambulanten Settings
In der aktuellen Versorgung hat die psychoanalytisch orientierte Psychotherapie in Deutschland nach wie vor einen beträchtlichen Anteil. Ambulant (in Praxen) machen analytische und tiefenpsychologische Behandlungen einen großen Teil aller langdauernden Psychotherapien aus – Schätzungen um 45–50% wurden für die letzten Jahre genannt. Viele psychologische Psychotherapeuten und ärztliche Psychotherapeuten bieten entweder reine Psychoanalyse, Tiefenpsychologie oder integrative Ansätze an. Allerdings nimmt der Anteil neuer Therapeuten mit psychodynamischer Ausrichtung ab (2017 waren es in Ausbildung nur ~13% in NRW, was künftig Auswirkungen haben könnte. Stationär (in Kliniken) spielt die Psychoanalyse traditionell eine große Rolle besonders in der Psychosomatischen Medizin. Zahlreiche psychosomatische Fachkliniken oder Reha-Kliniken wurden von Psychoanalytikern gegründet oder nach deren Konzepten betrieben. In diesen Einrichtungen ist das Behandlungskonzept häufig tiefenpsychologisch ausgerichtet, kombiniert mit kreativen und körperorientierten Therapieelementen. Patienten haben dort tägliche Gruppensitzungen, Einzeltherapie 1–2× pro Woche und es wird versucht, unbewusste Konflikte, die hinter körperlichen Symptomen oder psychosomatischen Erkrankungen stehen, aufzudecken. Auch in vielen psychiatrischen Kliniken gibt es psychoanalytisch geschulte Mitarbeiter; und Fallbesprechungen in Form von Balint-Gruppen (eine von Michael Balint entwickelte, psychoanalytisch basierte Gruppensupervision für Ärzte) sind weit verbreitet. Die Integrative Psychotherapie ist besonders im stationären Bereich inzwischen Standard: Es werden verschiedene therapeutische Methoden kombiniert, um den Anforderungen der Patienten und der knapp bemessenen Zeit gerecht zu werden. Ein integratives Modell der stationären Psychotherapie, wie Wolfgang Schneider es beschrieb, sieht vor, sowohl psychodynamische Elemente (Bearbeiten der Übertragung, Biographiearbeit) als auch verhaltensorientierte Module (Skill-Training, Entspannungsverfahren) und systemische Ansätze (Familiengespräche) einzubeziehen. Ziel ist, die Vorteile aller Ansätze zu nutzen – eine Entwicklung, die früher von manchen Analytikern skeptisch gesehen wurde („Verwässert das nicht die Psychoanalyse?“), heute aber häufig pragmatisch akzeptiert wird. Ambulant gibt es ebenfalls integrative Tendenzen: Viele Psychoanalytiker wenden bei Bedarf auch mal Verhaltenstechniken an (z.B. Exposition bei Phobien) im Rahmen einer ansonsten tiefenpsychologischen Therapie. Umgekehrt interessieren sich manche Verhaltenstherapeuten für psychodynamische Konzepte (z.B. Schematherapie integriert Bindungsmodelle und Übertragungsarbeit). Die starre Abgrenzung der Schulen weicht auf – was letztlich dem Patienten zugutekommt. Dennoch bleibt die klassische Setting-Differenzierung bestehen: Wer eine „richtige“ Psychoanalyse macht (3–5x pro Woche auf der Couch, non-direktiv), wird dies klar von einer Verhaltenstherapie unterscheiden. In Deutschland hat der Patient dank Kassenzulassung die Wahl zwischen unterschiedlichen Settings, und diese Vielfalt ist ein Markenzeichen des Versorgungssystems. Die Psychoanalyse sieht sich hier als tiefenpsychologischer Pol, der vor allem für komplexe, tiefgreifende Problematiken geeignet ist und auch Patienten hilft, die mit oberflächlichen Ratschlägen nicht weit kommen. Ihr Selbstverständnis heute ist oft, integrativer Teil eines Gesamtbehandlungsplans zu sein: Beispielsweise arbeitet ein analytischer Psychotherapeut mit einem Psychiater zusammen, der Medikamente verschreibt, oder mit Sozialarbeitern, die milieuorientierte Hilfen leisten. So hat sich die klassische Idee vom Analytiker als Einzelläufer in seinem Sessel zu einem Bild gewandelt, in dem Psychoanalyse ein Baustein im Bio-Psycho-Sozial-Modell der Versorgung ist. Gleichzeitig bewahrt sie in speziellen Kontexten (Ausbildungsinstituten, privatfinanzierte Analysen) auch ihr originäres intensives Format – dies jedoch meist außerhalb der Regelversorgung.
Selbstverständnis der Psychoanalytiker
Die heutige Generation von Psychoanalytiker*innen in Deutschland sieht sich sowohl als Therapeuten wie auch als Wissenschafter in einer besonderen Tradition. Einerseits stehen sie auf den Schultern Freuds und der großen Nachkriegslehrer (Thomä, Mitscherlich, Lorenzer, Richter u.a.), andererseits müssen sie sich im Wettbewerb mit anderen Therapieverfahren behaupten. Viele begreifen Psychoanalyse weiterhin als mehr denn nur eine Therapiemethode – nämlich als umfassende Theorie vom Menschen (eine „Kritische Theorie des Subjekts“, wie oben erwähnt). Damit verbunden ist oft ein gewisses elitäres Selbstverständnis: Die Ausbildung ist lang und intensiv, man durchläuft selbst eine Lehranalyse und liest umfangreiche theoretische Werke. Dies führt zu einem starken Identitätsbewusstsein als „Psychoanalytiker“. In der Außenwahrnehmung schwankt das Bild: Manche sehen sie als Intellektuelle im Therapeutenspektrum, die philosophisch und gesellschaftskritisch geschult sind; andere als Ewiggestrige, die an überholten Konzepten festhalten. Intern hat es in den letzten Jahrzehnten Öffnungsschritte gegeben – z.B. mehr Empirie-Orientierung bei jüngeren Analytikern, mehr Dialog mit Neuro- und Kognitionswissenschaft. Aber es gibt auch eine gewisse Fraktion, die nach wie vor Wert darauf legt, Psychoanalyse als andersartig zu definieren und nicht völlig im Mainstream der empirischen Psychologie aufzugehen. Dieses Spannungsfeld prägt das Selbstverständnis: Die Psychoanalyse pflegt einen gewissen Stolz auf ihre Tradition, sieht sich aber auch ständig herausgefordert, ihre Relevanz zu beweisen. Begriffe wie „unzeitgemäß“ werden dabei von der eigenen Zunft teils ironisch positiv umgedeutet („Wir sind absichtlich unzeitgemäß, weil wir Tiefgang bieten, wo Zeitgeist an der Oberfläche kratzt.“). Gleichwohl arbeiten Psychoanalytiker in Deutschland meist kollegial mit anderen Berufsgruppen zusammen und haben z.B. in den Psychotherapeutenkammern, Universitäten und Kliniken Funktionen inne – ihr Selbstbild ist also nicht mehr das vom abgekapselten Sonderling, sondern vom wichtigen Teil eines multiprofessionellen Teams, der eine besondere Perspektive (die Tiefendimension) einbringt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Psychoanalyse in Deutschland heute gleichzeitig einen gewissen Nischenstatus hat und doch unverzichtbarer Bestandteil der psychotherapeutischen Landschaft ist – eine paradoxe Situation, die die Fachgemeinschaft reflektiert und aktiv zu gestalten versucht.
Einfluss der neuen Psychotherapeutenausbildung
Neue Gesetzeslage (PsychThG 2019)
Mit der Reform der Psychotherapeutenausbildung, die 2019 beschlossen wurde und seit Wintersemester 2020/21 umgesetzt wird, hat sich die Ausbildungsstruktur grundlegend geändert. Anstatt wie früher nach Diplom/Master eine separate Ausbildung an Instituten zu durchlaufen, absolvieren angehende Psychotherapeuten nun ein Direktstudium (Bachelor + Master) der Psychotherapie mit staatlicher Approbationsprüfung am Ende des Masters. Daran schließt sich eine mehrjährige Weiterbildungsphase an, in der man sich auf ein Richtlinienverfahren spezialisiert (vergleichbar der Facharztausbildung). Diese Reform soll die Ausbildung wissenschaftlicher, schneller und finanziell besser planbar machen. Für die Psychoanalyse bringt sie jedoch einige Herausforderungen mit sich. Bisher war es üblich, dass Absolventen sich gezielt bei einem psychoanalytischen Institut (meist in Trägerschaft der DPV, DPG oder DGPT) bewarben und dort die tiefenpsychologische oder analytische Ausbildung machten. Diese Institute waren eigenständig für Theorie und Praxisvermittlung zuständig. Nun aber liegt der Schwerpunkt der Grundausbildung an den Universitäten, wo – wie in Abschnitt 2 ausgeführt – psychoanalytische Inhalte unterrepräsentiert sind. Psychoanalytische Verbände befürchten, dass in den neuen Studiengängen die Verfahrensvielfalt nicht ausreichend gelehrt wird. Der Approbationsordnung-Entwurf enthielt zwar das Ziel, alle wissenschaftlich anerkannten Verfahren zu berücksichtigen, aber es fehlten verbindliche Vorgaben, wie und durch wen dies geschehen soll. DGPT und andere kritisierten, das Studium könne faktisch fast rein verhaltenstherapeutisch ablaufen, da 60 von 61 Professoren diese Ausrichtung haben. Somit würde die Schere zwischen Universitätslehre (fast nur VT) und Praxisvielfalt (wo ~45% der Therapien psychoanalytisch sind) noch größer. Konfliktlinie: Hier stehen sich Universitäten und die traditionellen Institute gegenüber. Letztere haben zurecht Sorge um ihren Nachwuchs: „Die Absolvent:innen der neuen Studiengänge können die ‚alte‘ Ausbildung nicht mehr durchlaufen“ – das heißt, das bisherige Kurssystem der Institute gilt für sie nicht. Die Institute müssen sich also in die neue Weiterbildungsstruktur integrieren, z.B. als anerkannte Weiterbildungsstätten für den Schwerpunkt „Psychodynamische Psychotherapie“. Noch ist allerdings unklar, wie viele der Absolventen sich später für diesen Schwerpunkt entscheiden werden. Die DGPT verweist auf Zahlen: 2017 wählten nur 13% der Ausbildungsteilnehmer den psychoanalytischen Vertiefungsbereich (im alten System), während der Bedarf in der Versorgung ca. 45% psychoanalytische Therapien ist – es droht also eine Mangelversorgung in Zukunft, wenn dieser Anteil weiter sinkt. „Es droht auch ein Verschwinden der Psychoanalyse als bedeutsames Kulturgut“ warnt Schäfer von der DGPT. Die neuen Curricula stehen zudem zeitlich unter Druck: In 5 Jahren Studium lässt sich nur begrenzt tiefenpsychologisches Wissen vermitteln (neben allen anderen Inhalten). Es besteht die Gefahr, dass Psychoanalyse auf ein Minimum an Theorie zusammenschrumpft (vielleicht ein paar Vorlesungen Freud, etwas Bindungstheorie) und kaum praktische Übungen beinhaltet.
Auswirkungen auf Vermittlung psychoanalytischer Inhalte
In der Übergangsphase 2020–2030 wird sich zeigen, wie die psychoanalytischen Institute reagieren. Viele planen, mit Universitäten zu kooperieren, Gastvorlesungen anzubieten oder bei der praktischen Ausbildung (Praktika, Supervision) mitzuwirken. Tatsächlich haben einige Unis bereits Zusatzangebote geschaffen, z.B. Wahlpflichtmodule zu psychodynamischer Therapie. Das beste Szenario wäre, dass Studierende durch die frühe Konfrontation mit allen Ansätzen auch Interesse an Psychoanalyse entwickeln und sich dann bewusst dafür entscheiden. Das Worst-Case-Szenario ist, dass sie kaum Kontakt damit bekommen und daher später auch keine solche Weiterbildung wählen – wodurch langfristig der Nachwuchs an Analytikern schrumpft. Chancen: Die Reform könnte theoretisch die Psychoanalyse integrierter machen, da nun auch Universitäten Verantwortung für deren Grundlagen übernehmen müssen. Wenn es gelingt, genügend Hochschullehrer mit psychodynamischer Fachkunde einzubinden, könnten Studierende eine ausgewogenere Ausbildung erfahren als früher. Der Schritt der Einheitlichen Approbation könnte zudem das Ansehen psychodynamischer Verfahren heben – sie sind offiziell Teil des Kanons, kein „exotisches Aufbaumodul“. Konflikte: Allerdings gibt es berufs- und verbandspolitische Spannungen. Die Verhaltenstherapie-Lobby ist sehr stark an den Hochschulen vertreten und könnte die Gestaltung der Inhalte dominieren. Psychoanalytische Verbände wie DGPT und die Fachgesellschaften haben intensive Lobbyarbeit gemacht, um in der Approbationsordnung verankert zu werden. So wurde erreicht, dass der Begriff „Psychodynamische Psychotherapie“ explizit erwähnt wird. Doch die konkrete Ausgestaltung liegt bei den einzelnen Hochschulen. Es wird berichtet, dass einige Universitäten psychoanalytische Dozenten nur zögerlich integrieren – oder diese mangels Planstellen gar nicht verfügbar sind. Die DGPT fordert daher verpflichtende Anteile und hat auf die Politik eingewirkt, was bisher jedoch nur begrenzt Erfolg hatte. Ein weiterer Knackpunkt ist die Weiterbildungsordnung: Hier muss festgelegt werden, wie ein Psychotherapeut nach der Approbation den Titel z.B. „Fachpsychotherapeut für Psychodynamische Therapie“ erwerben kann. Die Bundespsychotherapeutenkammer arbeitet an Musterordnungen. Es ist wahrscheinlich, dass die Institute hierbei als Weiterbildungsstätten akkreditiert werden – so könnten sie ihre Expertise weiter einbringen. Dabei stehen Themen wie Dauer (wird es weiterhin Lehranalyse geben müssen? Wenn ja, wie viele Stunden?), Finanzierung (Wer bezahlt die Weiterbildung? derzeit unklar), und Inhalte (wie viel Theorie, welche Patientenbehandlungen) zur Debatte. Psychoanalytische Institute sehen Chance, ihr Curriculum als Maßstab einzubringen, aber auch Risiko, dass externe Gremien es verschulen könnten.
Stimmen und Reaktionen
Die Fachwelt reagiert gespalten. Die DGPT hat sehr deutlich von einer Gefahr für die Psychoanalyse gesprochen. Andere, wie einige jüngere Psychotherapeuten, sehen auch positive Aspekte: So könnten Psychoanalytiker durch die universitäre Verankerung an Sichtbarkeit gewinnen, anstatt wie bisher im Ausbildungsverlauf „unter sich“ zu bleiben. Zudem wird die finanzielle Ausbeutung der Ausbildungskandidaten (im alten System mussten diese oft Honorarausfälle selbst tragen etc.) durch das neue System entschärft – was vielleicht mehr junge Leute motiviert, einen langen Weiterbildungsweg zu gehen, ohne ruinöse Kosten zu scheuen. Lehrpraxen und Unikliniken werden künftig an der praktischen Ausbildung mitwirken. Sollte es gelingen, dass beispielsweise an Unikliniken psychoanalytische Ambulanzen mit Weiterbildungsassistenten entstehen, könnte dies neue Behandlungsangebote schaffen und die Verknüpfung von Forschung und Praxis fördern. – In Summe bringt die neue Ausbildung Chancen für eine Modernisierung und breitere Aufstellung der Psychoanalyse, aber auch Risiken, dass sie im Einheitsbrei untergeht. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, ob die Psychoanalyse ihren Platz behauptet. Erste Entwicklungen wie die in Frankfurt (Stiftungsprofessur) zeigen, dass die Community aktiv gegensteuert, um psychoanalytische Inhalte auf akademischem Niveau zu erhalten. Es liegt nun an der nächsten Generation von Lehrenden und Weiterbildnern, Psychoanalyse attraktiv, wissenschaftlich fundiert und klinisch relevant zu vermitteln, damit angehende Therapeuten die Faszination dieses Ansatzes erkennen und weitertragen.
Wichtige Literatur und Quellen
Abschließend ein Überblick über einige zentrale Literaturquellen – von klassischen Werken bis zu aktuellen Studien – sowie relevante Dokumente und Datenbanken:
- Klassische Werke der Psychoanalyse:
- Sigmund Freud: Die grundlegenden Schriften Freuds bilden das Fundament. Hervorzuheben sind „Die Traumdeutung“ (1900) – Freuds epochales Werk über das Unbewusste in Träumen, „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ (1905) – Grundlegung der psychosexuellen Entwicklung, und „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ (1917) – populäre Zusammenfassung seiner Theorien. Freuds „Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung“ (1914) gibt zudem einen historischen Abriss in Freuds eigener Sicht. Viele von Freuds Werken sind in den Gesammelten Werken auf Deutsch verfügbar, oder in englischer Standard Edition.
- Karl Abraham: Als Freud-Schüler in Berlin verfasste er bedeutende klinische Beiträge, z.B. Schriften zur Psychoanalyse der Manie und Melancholie (1911/1912). Abraham gilt als Mitbegründer der psychoanalytischen Charakterlehre (Schriften 1925).
- C.G. Jung: Obwohl Jung sich 1913 von Freud trennte, ist sein Buch „Symbole der Transformation“ (1912) historisch bedeutsam. Ebenso Jungs späteres Hauptwerk „Psychologische Typen“ (1921), das seine Abkehr von Freud manifestierte. Jung prägte Begriffe wie Kollektives Unbewusstes und Archetypen.
- Alfred Adler: Adlers „Praxis und Theorie der Individualpsychologie“ (1920) und „Der nervöse Charakter“ (1912) sind grundlegende Werke seiner individualpsychologischen Schule, die einst Teil der Freud’schen Bewegung war.
- Alexander Mitscherlich: Wichtigster Vertreter der Nachkriegspsychoanalyse in Deutschland. Sein bekanntestes Werk „Die Unfähigkeit zu trauern“ (1967, mit Margarete Mitscherlich) analysiert die kollektive Verdrängung der Nazi-Schuld. Ebenfalls bedeutend: „Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“ (1963) über den Autoritätszerfall in der modernen Gesellschaft, und „Medizin ohne Menschlichkeit“ (1949, mit Fred Mielke) – eine Dokumentation der Ärzteverbrechen im Dritten Reich, entstanden aus Mitscherlichs Beobachtung der Nürnberger Ärzteprozessetagesspiegel.detagesspiegel.de. Mitscherlichs Arbeiten verbinden psychoanalytische und sozialpsychologische Perspektiven und sind Schlüsseltexte der deutschen Kulturgeschichte.
- Helmut Thomä & Horst Kächele: „Psychoanalytische Therapie“ (erste Auflage 1985) – ein zweibändiges Lehrbuch, das als Standardwerk der Ausbildung gilt. Es integriert klassische Theorie mit moderner Therapietechnik und Forschung. Thomä/Kächele bieten auch viele Fallbeispiele und haben die empirische Wende in der deutschen Psychoanalyse mit vorbereitet.
- Hans Loewald: Obwohl in den USA wirkend, war Loewald deutschsprachiger Abstammung. Sein Essay „Internalisierung, Separation, Verlust“ (1951) und andere Schriften (deutsch in „Die psychoanalytische Theorie neu denken“) beeinflussten die neuere theoretische Diskussion (Integration von Objektbeziehungstheorie in die klassische Metapsychologie).
- Horst-Eberhard Richter: „Eltern, Kind und Neurose“ (1963) – ein populäres Werk zur psychoanalytischen Familienpsychologie, das im Nachkriegsdeutschland viele Auflagen erlebte. Richter verbindet individualpsychopathologische und gesellschaftliche Betrachtungen (später auch in „Die Gruppe, der Einzelne und die Psychoanalyse“, 1972).
- Aktuelle Forschungsliteratur (Wirksamkeitsnachweise):
- Meta-Analysen: Eine Fülle von Meta-Analysen in internationalen Journalen bestätigt die Effektivität psychodynamischer Psychotherapie. Beispiel: Diener et al. (2014), The efficacy of psychodynamic psychotherapy across mental disorders, in American Journal of Psychiatry; Steinert et al. (2017), Dropout and non-improvement in psychodynamic therapy (Metaanalyse zu Abbruchraten); Abbass et al. (2014) Meta-Analyse zur Kurzzeit-Tiefenpsychotherapie bei somatischen Störungen. – Shedler (2010) in American Psychologist ist eine oft zitierte Übersichtsarbeit, die viele Studien zusammenfasst und der Psychodynamischen Therapie ein Gütesiegel erteilt (Effektstärken ~0.85 bei komplexen Störungen, länger andauernde Effekte)Spezifische Studien: Die Tavistock-Depressionsstudie (London, 2015) zeigte Wirksamkeit einer 18-monatigen Psychoanalyse bei chronischer Depression im Vergleich zu TAU (Treatment as usual). Leichsenring et al. (2009) führten eine vielbeachtete RCT durch, in der Langzeit-Psychotherapie gegen CBT bei Generalisierter Angststörung getestet wurde – beide waren effektiv, die psychodynamische sogar mit weiterer Verbesserung im Follow-Up. – In Deutschland lief die Langzeittherapie-Studie der DPV (Studienleitung Falk Leichsenring, und zuvor die Ulmer Arbeitsgruppe um Rolf Sandell), die langfristige Verläufe analysierte.Prozess-Outcome-Forschung: Wichtige aktuelle Artikel untersuchen, wie psychoanalytische Therapie wirkt. Z.B. Johannes Glas et al. (2018) zur Bedeutung der Übertragungsdeutung (eine systematische Übersicht in Psychotherapie), Høglend et al. (2011) zu moderierenden Variablen bei Übertragungsfokus, Crits-Christoph et al. zur therapeutischen Allianz in unterschiedlichen Phasen. – Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) hat mittlerweile eine Reihe von Forschungsbeiträgen; etwa OPD-2 Task Force (2006), Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik 2 (Manual) und Aufsätze über die Validierung der OPD-Achsen (z.B. Cierpka & Grande, 2008, in Psychotherapeut).Neuroscience und Psychoanalyse: Solms & Turnbull (2002), The Brain and the Inner World – ein Buch, das neurologische Erkenntnisse mit psychoanalytischen Konzepten verknüpft. Zeitschrift Neuropsychoanalysis (ab 1999) mit vielen Artikeln, z.B. von Kaplan-Solms über Hirnläsionen und Persönlichkeitsveränderungen (Fallstudien, die Freuds alte „Hirnpsychologie“ modern fortführen).
- Recherchedatenbanken: Um aktuelle Studien zu finden, sind PsycINFO (American Psychological Association) und PubMed (medizinische Datenbank) die wichtigsten Quellen. Eine Stichwortsuche nach „psychodynamic psychotherapy outcome“ oder „psychoanalysis process research“ liefert dort zahlreiche Treffer. Auch das Portal Psychoanalytical Electronic Publishing (PEP-Web) bietet Zugriff auf psychoanalytische Fachzeitschriften (wie International Journal of Psychoanalysis, Psyche, RISS etc.), inkl. Archiv klassischer Aufsätze.
- Philosophisch-epistemologische Grundlagenliteratur:
- Karl Popper: Seine Kritik an Psychoanalyse findet sich v.a. in „Konjekturen und Refutationen“ (1963, engl. Conjectures and Refutations) und bereits angedeutet in „Logik der Forschung“ (1934) im Abschnitt über Pseudowissenschaft. Poppers Werke sind essenziell, um die Abgrenzungsdiskussion (wissenschaftlich vs. unwissenschaftlich) zu verstehen.
- Jürgen Habermas: „Erkenntnis und Interesse“ (1968) – besonders das Schlusskapitel zur Psychoanalyse als Selbstreflexionswissenschaft. Auch Habermas’ Aufsatz „Die psychoanalytische Theorie der seelischen Vorgänge“ (1965) ist relevant. Habermas liefert eine Gegenposition zu Popper und begründet die Psychoanalyse als dritte Erkenntnisart (neben analytisch und hermeneutisch eine kritisch-emanzipatorische).
- Paul Ricœur: „Freud und die Philosophie“ (1965, frz.) – interpretiert Freuds Theorie als eine Hermeneutik des Verdachts. Zeigt eine philosophische Würdigung der Psychoanalyse und grenzt sie von reiner Naturwissenschaft ab.
- Adolf Grünbaum: „Die Grundlagen der Psychoanalyse“ (1984, engl. 1985, dt. 1991) – gründliche Analyse der Logik von Freuds Theorie und ihrer empirischen Belegbarkeit. Grünbaum argumentiert u.a., Freuds klinische Beweisführungsstrategie (die sogenannte Tally Argumentation: dass die Deutung stimmt, wenn der Patient zustimmt und sich bessert) sei logisch unzureichend. Dieses Werk ist wohl die umfassendste philosophische Kritik an Freud und wird häufig zitiert.
- Hans-Georg Gadamer vs. Habermas Debatte: In den 1960ern entstand eine Kontroverse zwischen Gadamer (hermeneutische Tradition) und Habermas, wobei Psychoanalyse als Beispiel diente. Gadamers „Hermeneutik“ (Wahrheit und Methode, 1960) geht implizit anders mit Psychoanalyse um (als Gesprächsprozess) als Habermas (als Theorie mit Erkenntnisinteresse). Diese Debatte ist in Sammlungen dokumentiert.
- Wolfgang Müller-Busch / Günter Gödde / Jürgen Körner: Dies sind deutsche Autoren, die sich mit Wissenschaftstheorie der Psychoanalyse befassten. Z.B. Gödde/Körner (Hrsg.): „Psychoanalyse und Wissenschaft“ (2000) – enthält Aufsätze zur aktuellen Epistemologie.
- Franz Rudolf Schmidt: „Die Wissenschaftlichkeit der Psychoanalyse“ (1970) – klassische Darstellung pro Psychoanalyse, heute historisch interessant.
- Lorenzer & Nürnberg (Hrsg.): „Spiegel und Gleichnis“ (1974) – enthält Beiträge zur Dialektik in der Psychoanalyse, auch epistemologische Beiträge (Alfred Lorenzer etwa betonte den Sprachcharakter der analytischen Erkenntnis).
- Aktuelle Diskurse: In jüngerer Zeit werden epistemologische Fragen z.B. im Journal of the American Psychoanalytic Association diskutiert – etwa über den Evidenzbegriff in der Psychoanalyse (vgl. Howard Levine et al. (2010) über klinische vs. empirische Evidenz). In Deutschland beleuchtet das Psychotherapeutenjournal solche Themen (2018 gab es ein Heft „Quo vadis WBP?“ über Wissenschaftskriterien)