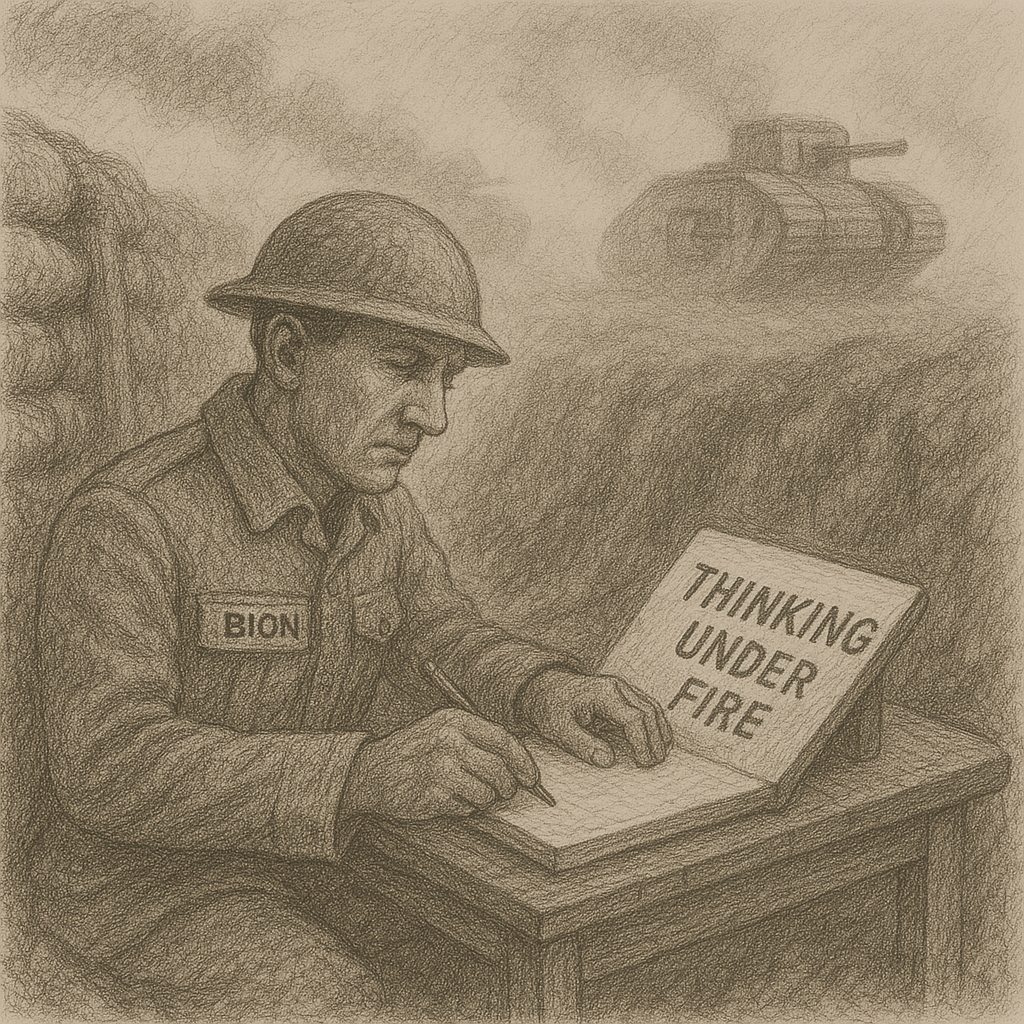
Die gegenwärtige Weltlage ist von tiefgreifenden Umbrüchen und Verunsicherungen geprägt: Autoritäre Strömungen gewinnen an Einfluss, während globale Konflikte – wie etwa Russlands Krieg gegen die Ukraine – und die veränderte amerikanische Innen- wie Außenpolitik grundlegende Überzeugungen der liberalen Demokratie und die bisherige sicherheitspolitische Ordnung ins Wanken bringen.
Außenpolitisch stehen wir vor einem neuen Systemwettbewerb: Autoritäre Mächte propagieren ihr Modell als effizienter oder „echter“ als die vermeintlich dekadenten westlichen Demokratien. Die Abwendung der US-Regierung vom demokratischen Europa und Hinwendung zu einem diktatorisch regierten Russland etwa wäre (ist?) eine geopolitische Zäsur, die Europas Sicherheit fundamental erschüttert.
Innenpolitisch wachsen gleichzeitig autoritäre Versuchungen in unseren eigenen Gesellschaften. Populistische Parteien und Bewegungen gewinnen Zulauf, indem sie einfache Lösungen und starke Führung in unsicheren Zeiten versprechen. In Deutschland hat die rechtsextreme AfD ihren Einfluss massiv ausgebaut. Historiker Wolfgang Benz zog bereits Parallelen zur Lage von 1933: Er warnt, dass die aktuelle Renaissance völkischer Ideologie nur durch Vergessen, Verharmlosen oder Verleugnen der NS-Vergangenheit möglich ist (bpb.de). Die Demokratie befinde sich auf gefährlichem Terrain, wenn bürgerliche Kräfte aus Angst vor Instabilität taktieren oder gar mit den Feinden der offenen Gesellschaft paktieren. Benz spricht von zwei gleichzeitigen „Zeitenwenden“: einer weltpolitischen (Erosion der transatlantischen Partnerschaft) und einer innenpolitischen (Rechtsruck in Deutschland), die zusammen die Nachkriegsordnung ins Wanken bringen. Angesichts dieser Entwicklungen ist die liberale Demokratie „so heftig attackiert wie lange nicht mehr“ (spiegel.de).
All dies mag beängstigend und verstörend, verlockend oder auch verführerisch sein, mag Denkräume okkuppieren oder zur Verdrängunge einladen. Wir stehen hier an einem Punkt, an dem psychoanalytische Perspektiven einen wichtigen Beitrag leisten können, weil sie als “Drittes” Raum schaffen können. Bereits Sigmund Freud (1908, 1915, 1930 u.a.) hatte Psychoanalyse nicht nur als klinische Methode, sondern als umfassendes kulturkritisches Projekt konzipiert: So wie sie unbewusste Konflikte beim Einzelnen erschließt, kann sie auch gesellschaftliche Illusionen, kollektive Projektionen und Spaltungstendenzen sichtbar machen. Schon früh suchten Psychoanalytiker*innen zu verstehen, warum autoritäres Denken auf fruchtbaren Boden fällt – auch bei uns selbst (und wie schnell man in die Spaltungen wir gegen die fällt, selbst wenn ich hier von “uns” schreibe). Psychoanalytische Modelle psychische können Dynamiken herausarbeiten, die öffentliche Debatten und Entscheidungsprozesse beeinflussen. Statt lediglich auf Oberflächenphänomene – Wahlergebnisse, militärische Drohgebärden, polternde Rhetorik – zu schauen, lenkt die psychoanalytische Beschäftigung unsere Aufmerksamkeit auf die inneren Beweggründe kollektiver Stimmungslagen: Wie entstehen Feindbilder durch Projektion? Weshalb suchen Menschen in Krisenzeiten eine „starke Hand“, anstatt Freiheit und Pluralität zu verteidigen? Welche unbewussten Ängste und Kränkungen lassen autoritäre Parolen so verführerisch wirken?
Diese Fragen sind in öffentlichen Debatten, die sich um autoritäre Bedrohungen, populistische Bewegungen oder geopolitische Umbrüche drehen, enorm wichtig. Doch wo sind sie alle, die psychoanalytischen Stimmen in der Diskurs-„Arena“ (um den passenden Begriff von Steffen Maus Triggerpunkte zu verwenden)? Warum gibt es so wenig öffentliche Stellungnahmen von Psychoanalytiker*innen zu den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen? Bereits 1978 kritisierte Paul Parin in seiner Glosse „Warum die Psychoanalytiker so ungern zu brennenden Zeitproblemen Stellung nehmen“ (Parin 1978), dass die Psychoanalyse – obwohl von Freud eindeutig auch als Gesellschaftskritik angelegt – in eine Art defensives Schweigen geraten sei. Aus einer „emanzipatorischen Wissenschaft“ sei durch Medizinalisierung, das Herausdrängen nicht-ärztlicher Intellektueller und den Ausbau standespolitischer Institutionen eine „Kaste“ geworden, die vornehmlich darauf bedacht sei, therapeutisches Fachwissen zu vermitteln und ihre sozial privilegierte Stellung zu sichern. Brennende Zeitfragen seien in den Publikationen kaum reflektiert worden. In der Neuauflage der Kritik ist 2007 von Decker, Rothe und Brosig wurde untersuchte, wie viele Beiträge aktueller Fachzeitschriften sich dezidiert mit „brennenden Zeitproblemen“ befassten. Das ernüchternde Ergebnis: Nur ein kleiner Bruchteil psychoanalytischer Arbeiten (etwa 17% in den von ihnen untersuchten Jahrgängen) nahm explizit zu aktuellen gesellschaftlichen Konflikten Stellung. Somit bestätige sich, so Decker et al., weitgehend Parins Befund.
Zum Stichwort Medizinalisierung: Die Psychoanalyse ist traditionell in ein enges Ausbildungs- und Gesundheitssystem eingebunden. Wer jahrelang eine streng reglementierte Ausbildung durchläuft und auf Abrechnungsgenehmigungen angewiesen ist, wägt häufig ab, ob eine öffentlich-politische Stellungnahme womöglich dem Ruf oder beruflichen Sicherheiten schaden könnte. Es kommen also ökonomische und standespolitische Aspekte ins Spiel, die unbewusst ein „Zurückweichen“ vor politisch brisanten Themen begünstigen.
Zudem existiert in der psychoanalytischen Community ein historisch gewachsener Abgrenzungswunsch: Da sich die Psychoanalyse lange gegen Vorwürfe behaupten musste, sie sei unwissenschaftlich oder „ideologisch“, pflegt sie – gerade in ihren etablierten Institutionen – häufig eine Haltung der Zurückhaltung. Sie will nicht vorschnell politisch vereinnahmt werden. Manches davon ist eine Professionalitäts- und Neutralitätsidee, die in einer verkürzten Auslegung heißt: „Die Couch und die Klinik sind unser Feld, gesellschaftspolitische Analysen dürfen wir nicht vermischen.“ Psychoanalytische „Abstinenzregeln“ in der Therapie werden dann unbewusst als Abstinenz auch gegenüber öffentlichen Debatten missverstanden – obwohl gerade ein bewusster Umgang damit durchaus andere Zugänge eröffnen könnte. Erschwerend kommt hinzu, dass Psychoanalytiker*innen gewohnt sind, in langen Prozessen, in intimen Settings zu arbeiten, in denen Zeit, Geduld und das Aufdecken von Widerständen eine zentrale Rolle spielen. Öffentliche Diskurse hingegen sind oft laut, schnell und auf Effekthascherei ausgerichtet. Viele befürchten, dass psychoanalytische Reflexionen im Schnellfeuer der Medien verkürzt oder trivialisiert werden („Halten Sie Putin für narzisstisch?“, „Ist Trump unbewusst eigentlich …?“ etc.).
Mit Paul Parin und anderen Kritiker*innen kann man außerdem fragen, ob nicht auch in der psychoanalytischen Community selbst kollektive Abwehrmechanismen wirken. Die Erfahrung, dass sich Institutionen über Jahre stark professionalisiert und konserviert haben, führt zu unbewusster „Konfliktscheu“ gegenüber kontroversen Fragen. Man bleibt in vermeintlich sicheren Gefilden klinisch-therapeutischer Fachlichkeit, statt die Konfrontation mit gesellschaftlichen Phänomenen zu suchen. Somit wird – ohne dass es jemand offen ausspricht – eine Art Selbstbeschränkung praktiziert.
Genau deswegen versucht die hier vorgestellte Seite – in Anlehnung an Parins Appell, aber auch aufbauend auf neueren Autor*innen – auf den Schultern von Riesen stehend einen Raum zu schaffen, in dem psychoanalytische Impulse zu aktuellen Krisen sichtbarer werden. Hierfür finden Sie unten eine Auswahl an Literatur, die den Versuch macht, Psychoanalyse und Politik explizit zusammenzudenken – quasi eine Art Gegenimpuls zu jener „Apathie“ oder „Abstinenz“ darstellen, von der Parin sprach. Diese Seite soll aufzeigen, dass die psychoanalytische Community – mit all ihrer Vielfalt an Theorietraditionen – durchaus ein Ort sein kann, an dem wir unser Unbehagen mit autoritären Strömungen reflektieren und vertiefen können.
Vor der Literatursammlung möchte ich selbst einen Blick auf zentrale psychoanalytische Arbeiten werfen, beginnend mit einer klassischen Perspektive auf autoritäre und populistische Dynamiken: Erich Fromm (1941) beschreibt in seiner „Furcht vor der Freiheit“, wie dass Menschen in gesellschaftlichen Umbrüchen gern „aus der Freiheit fliehen“ und sich autoritären Idealen unterwerfen, weil ihnen diese das Versprechen von Sicherheit vermitteln. Ebenso mittlerweile ein Klassiker der Frankfurter Schule sind Adornos und Horkheimers (1973) Studien zum autoritären Charakters, die u.a. Zeigen, wie in unsicheren Zeiten ein starkes Bedürfnis nach Ordnung und Gehorsam erwachen kann, das in Verbindung mit Ressentiment gegen vermeintlich „Andere“ zu einer explosiven Mischung wird.
Neuere Autoren wie Diamond (2023) und Zienert-Eilts (2020) sprechen von „perverted containing“: Populistische Führungsfiguren treten als vermeintliche „Hüter“ einer Gemeinschaft auf, binden aber die Ängste und Sehnsüchte ihrer Anhängerschaft in manipulativer Weise an sich. Statt echter Orientierung bieten sie projektive Feindbilder und simple Schuldzuweisungen. Mit Messina (2022) können wir die Projektionen (und projektive Identifikationen) genauer analysieren: Sie zeigt, wie gesellschaftliche Gruppen eigene Ängste oder Kränkungen nach außen wenden (also projizieren) und Migranten, Andersdenkende oder ganze Staaten zu Sündenböcken machen. So entstehen Fantasien von Allmacht („wir sind die einzig Gerechten“) und ohnmächtiger Bedrohung („die da wollen uns zerstören“), die populistische Rhetorik befeuern. Ottomeyer (2022) verweist darauf, wie diese Ängste eng mit politischer Desinformation verbunden sind; kollektive Angst kann rasch in autoritäres Denken umschlagen, wenn Propagandisten sie geschickt instrumentalisieren.
Slavoj Žižek (2016) unterstreicht dabei die Ambivalenzen: Er sieht im gegenwärtigen Umgang mit Terror oder Geflüchteten eine „doppelte Erpressung“, in der sich Angst und moralische Idealisierung verkeilen. In ähnlicher Weise hebt Illouz (2023) hervor, dass populistische Mobilisierungen häufig von einer Mischung aus Ekel, Scham, Ressentiment und Kränkung leben – Emotionen, die rationalen Argumenten kaum zugänglich sind und leicht in eine antiliberale Stoßrichtung kanalisiert werden können. Fleury (2023) spricht deshalb von der Macht des Ressentiments, das einst unterdrückte Wut und Unterlegenheitsgefühle zum zentralen Antrieb politischer Vergeltungsfantasien machen kann.
Wie sehr Inszenierungen von Anführern mit in einer Gefolgschaft (selbstobjekthafte) Bedürfnisse bedriedigt zeigen Bruenig (2024) und Olivier (2021) an der Figur Donald Trumps: Narzisstische Inszenierungen treffen auf kollektive Sehnsüchte und erzeugen so eine Massenloyalität, die ungeachtet offensichtlicher Widersprüche fortbesteht. De Barros (2020) betont, dass in solchen Konstellationen oft „jouissance“ – eine Mischung aus Lust und Leiden – im Spiel ist, die das Gemeinschaftsgefühl zusammenschweißt und rationale Abwägungen verdrängt. Figlio (2023) verweist dabei auf die Rolle eines „autoritären Über-Ichs“, das Schuld- und Schamgefühle bei den Anhängern dämpft und dem „Führer“ nahezu blinde Gefolgschaft sichert.
Betrachtet man die globale „Sicherheitswende“ oder den (drohenden) Bruch transatlantischer Allianzen, so könnten diese Dynamiken weiter eskalieren. Richards (2024) beschreibt eine „autoritäre/libertäre Hybrid“-Struktur, in der Menschen einerseits nach vermeintlich absoluter Freiheit rufen und gleichzeitig strikte Führung einfordern – ein paradoxes Muster, das besonders in Krisenzeiten attraktiv wirkt. Philipson (2024) wiederum zeigt, wie autoritäre Staaten auf denselben unbewussten Verdrängungs- und Verschiebungsmechanismen aufbauen, die Bürgerschaften anfällig für Spaltung und Hass machen. Luks (2024) greift n Freuds Begriffe von Eros und Thanatos auf, um zu illustrieren, dass in Krisen Aggression und Zerstörung (Thanatos) gegenüber bindenden Kräften (Eros) massiv an Boden gewinnen können; zugleich hebt Luks die Notwendigkeit eines „emotion-transzendierenden Logos“ hervor, der jenseits von Abschottung und Affektherrschaft einen Raum für Bewusstheit und Vernunft schafft.
In ihrem Kern betonen die versammelten Beiträge, wie essentiell es ist, unbewusste Triebkräfte und Abwehrmechanismen, die autoritäres Denken und Handeln leiten, zu entschlüsseln. Denn in Phasen politischer oder sicherheitspolitischer Umbrüche – seien es Ängste vor militärischer Bedrohung, vor ökonomischen Krisen oder vor kultureller „Überfremdung“ – wirken tiefe Verletzlichkeiten und verzerrte Wahrnehmungen zusammen und drohen, die liberale Demokratie von innen aufzuweichen. Wo klassische Politik- und Strategiedebatten an ihre Erklärungsgrenze stoßen, kann das „Dritte“ der Psychoanalyse verdeutlichen, wie stark Projektion, Regression und aggressiv aufgeladene Abwehr im gesellschaftlichen Raum wirksam sind. Dies zu erkennen, schafft eine Möglichkeit, der Faszination von Spaltung entgegenzutreten und die Bereitschaft zu stärken, sich kritisch mit den eigenen Unbewusstheiten auseinanderzusetzen.
Hier nun eine Zusammenstellung von Literatur zum Thema. Ein Klick auf den Pfeil öffnet die Zusammenfassung (teils von mir erstellt, teils aus dem Abstract des Textes) und wenn der Text online verfügbar ist, gelangt man über einen Klick auf den Titel dorthin.
Fromm, E. (1941). Die Furcht vor der Freiheit: Escape from Freedom.
Fromm zeigte, dass Freiheit für viele Menschen auch etwas Beängstigendes hat: Sie bedeutet Verantwortung, Unsicherheit und die Last, selbst Sinn schaffen zu müssen. Aus dieser Überforderung heraus entstehen laut Fromm drei typische „Fluchtmechanismen“
- Flucht ins Autoritäre: Das Individuum unterwirft sich freiwillig einer stärkeren Autorität, um der eigenen Angst und Entscheidungsnot zu entkommen. Indem man sich einem „starken Mann“ oder einer Ideologie anschließt, hofft man auf Schutz und einfache Antworten. Freiheit wird gegen Sicherheit getauscht.
- Flucht ins Destruktive: Manche entladen ihre Ohnmachtsgefühle in blinder Wut und Zerstörungswut gegen andere. Anstatt die Unsicherheit auszuhalten, wird aggressiv um sich geschlagen – oftmals angestachelt durch autoritäre Agitatoren, die Feindbilder liefern.
- Flucht in den Konformismus: Viele Menschen flüchten in die anonyme Masse und passen sich einfach an die vorherrschenden Meinungen an. Indem man „mitschwimmt“ und nicht auffällt, hofft man, dem Druck der Freiheit zu entgehen. Diese Gleichschaltung kann autoritäre Bewegungen enorm stärken, weil Widerstand durch eigenständiges Denken ausbleibt.
Fromm betonte, dass all diese Mechanismen unbewusst ablaufen und tief in der Persönlichkeit verankert sein können. Die scheinbare Faszination des Autoritären wurzelt also oft in Gefühlen von Angst, Einsamkeit und Überforderung. Wenn die Welt chaotisch erscheint, wirkt ein Führer, der absolute Gewissheiten verkündet, psychologisch attraktiv. Autoritäre Propaganda knüpft gezielt daran an: Sie schürt Bedrohungsgefühl, sät Zwietracht und verspricht dann eine vermeintliche Erlösung durch Ordnung und Stärke.
Adorno, T. W., Weinbrenner, M., & Friedeburg, L. V. (1973). Studien zum autoritären Charakter. Suhrkamp.
Die Autoren zeigen, dass bestimmte Persönlichkeitszüge – etwa starres dichotomes Denken, Unterwürfigkeit gegenüber „Oben“ und Aggression gegen „Unten“ – häufig Resultat einer strengen, lieblosen Erziehung sind. Ein Kind, das in einem sehr patriarchalischen, repressiven Umfeld aufwächst, internalisiert oft das Prinzip, dass Gehorsam Tugend und eigenes Denken Gefahr bedeute. Später neigt so jemand stärker dazu, autoritären Führern zu folgen und Sündenböcke für die eigenen Probleme zu akzeptieren. Mit anderen Worten: Autoritäre Regime nutzen jene „schlafenden Hunde“ in uns – die latenten autoritären Neigungen – und wecken sie unter den richtigen gesellschaftlichen Bedingungen (etwa in Krisenzeiten). Dies soll den Autoren zufolge erklären, warum der Boden für Autoritarismus manchmal so fruchtbar ist.
Messina, K. E. (2022). Resurgence of global populism: A psychoanalytic study of projective identification, blame-shifting and the corruption of democracy. Routledge.
Die britische Psychoanalytikerin Melanie Klein beschrieb schon in den 1940er Jahren den Abwehrmechanismus der projektiven Identifikation: Menschen spalten unerträgliche eigene Gefühle oder Impulse ab und projizieren sie in andere hinein, um sie dort zu bekämpfen. Karyne E. Messina, eine zeitgenössische Psychoanalytikerin, hat dieses Konzept auf die Politik übertragen. In Resurgence of Global Populism (2022) analysiert sie, wie populistisch-autoritäre Führer gezielt Blame-Shifting (Schuldverschiebung) und projektive Identifikation einsetzen, um Anhänger zu gewinnen. Der Populist bietet dem verunsicherten Bürger ein simples Narrativ an: Nicht wir sind schuld an unseren Problemen, die Anderen sind es – “die Ausländer”, “die korrupten Eliten”, “die Minderheiten”, je nach Bedarf. All das, was im eigenen Lager als Makel empfunden wird, wird auf diese Feindgruppe projiziert. Durch diese Projektion fühlen sich Anhänger moralisch entlastet und vereint. Messina beschreibt, wie insbesondere Donald Trump mit drastischen, spaltenden Aussagen gezielt Ängste schürt und Gegner zu Sündenböcken stilisiert. Er bezeichnet Migranten pauschal als Kriminelle, die Presse als „Feind des Volkes“ oder politische Konkurrenten als „bösartig“ und „betrügerisch“. Diese ungeheuerlichen Behauptungen – so absurd sie objektiv sind – erfüllen psychologisch ihren Zweck: Sie lenken Aggressionen von der eigenen Gruppe weg und bündeln sie auf ein Außenobjekt. Trumps Anhänger können so eigene Unsicherheiten, Wut oder Ressentiments nach außen verlagern und in blinde Empörung über „die Anderen“ ummünzen. Messina betont, dass diese systematische Schuldverschiebung Chaos stiftet und die Gesellschaft spaltet, was dem Autoritären nützt. Denn solange verschiedene Gruppen gegeneinander aufgehetzt sind, bleibt der Ruf nach einem „starken Mann“, der Ordnung schafft, laut. Projektive Identifikation wirkt hierbei doppelt: Erstens glauben die Anhänger tatsächlich, dass das Böse vollständig im Feind steckt (während die eigene Gruppe gut und unschuldig ist) – was extreme Maßnahmen gegen den Feind rechtfertigt. Zweitens verhalten sich Anhänger oft so, dass sie das Feindbild gleichsam bestätigen. Ein Beispiel: Wird behauptet, die andere politische Seite wolle die Nation zerstören, so rechtfertigt dies im eigenen Lager nahezu jedes Mittel, um diese Gefahr abzuwenden (Notstandsrhetorik). So erkläre sich, warum viele Menschen demokratische Normen über Bord werfen: Im Namen der Abwehr des projizierten Bösen erlauben sie ihrem Führer und sich selbst jede Überschreitung. Als am 8. Januar 2023 in Brasilia tausende Bolsonaro-Anhänger gewaltsam den Kongress und weitere staatliche Gebäude stürmten, taten sie dies im Wahn, die Wahl von Bolsonaro sei gestohlen und nur durch einen Angriff auf die Institutionen könne man „das Vaterland retten“. Die Parallele zum Sturm auf das US-Kapitol (6. Januar 2021) ist offensichtlich. In Brasilien wurden über 1200 Aufrührer verhaftet, doch viele sehen sich bis heute als Patrioten, nicht als Täter. Die autoritäre Massenpsychologie hat hier also Menschen dazu gebracht, Demokratie im Namen der Demokratie zu zerstören, weil sie ihre eigenen antidemokratischen Impulse auf die Gegenseite projiziert hatten („Die Anderen sind die Feinde der Freiheit, wir müssen sie mit undemokratischen Mitteln stoppen“).
Diamond, M. J. (2023). Perverted containment: Trumpism, cult creation, and the rise of destructive American populism. Psychoanalytic Inquiry, 43(2), 96-109.
Unter Rückgriff auf die Beiträge von Psychoanalytikern, die von Bion beeinflusst wurden, sowie auf sozialpolitische Historiker untersucht der Autor den Trumpismus und dessen destruktive Führung . Der Artikel zeigt, dass ein rachsüchtiger, narzisstischer und toxisch-männlicher Anführer wie Ex-Präsident Trump die enthaltende Funktion gesunder Führung „pervertiert“, um autoritäre Herrschaft auszubauen. Der Autor erläutert, dass dann, wenn die unbewussten Phantasien einer Gruppe mit einer bösartigen, narzisstischen Führung zusammenpassen, die Grundlage für die Entwicklung eines bösartigen Personenkults geschaffen wird. Der Kult des Trumpismus fördert und instrumentalisiert Paranoia sowie die Loyalität zu einer allmächtigen, charismatischen Figur, wodurch ein gesellschaftliches Klima entsteht, das die demokratischen Prinzipien zu untergraben und den Faschismus zu begünstigen droht. Im Gegensatz dazu illustriert der Autor zum Abschluss gesunde Containment-Prozesse, die potenziell destruktive psychotische Ängste und Phantasien neutralisieren, anhand einfühlsamer und inspirierender Reden von Abraham Lincoln und Robert F. Kennedy.
Ottomeyer, K. (2022). Angst und Politik. Psychosozial-Verlag.
Der Sozialpsychologe Ottomeyer analysiert in diesem Buch die “Wellen der Angst” in zeitgeschichtlichen Krisen (von der Anti-Atom-Bewegung der 1980er bis zu Klima-, Flüchtlings- und Corona-Krise) und deren politische Folgen. Er plädiert – im Anschluss an Freud – für eine Unterscheidung von Realangst, Gewissensangst und neurotischer Angst. Während realistische Sorgen und moralische Gewissensangst zu solidarischem Handeln motivieren können, bergen neurotisch-paranoide Ängste die Gefahr einer “gefährlichen Drift zu Autoritarismus”. Ottomeyer zeigt, wie rechtspopulistische Bewegungen solche diffusen Ängste missbrauchen, etwa indem “der Fremde als Container für verpönte Regungen” dient. Zugleich hebt er positive Beispiele hervor, in denen bürgerschaftlicher Widerstand und Empathie der Angstpolitik entgegenstehen und die Demokratie verteidigen.
Žižek, S. (2016). Against the double blackmail: Refugees, terror and other troubles with the neighbours. Penguin UK.
Žižek diagnostiziert eine ideologische Paranoia: Selbst wenn einzelne Vorurteile gegen Zuwanderer (etwa Kriminalität) Faktenkern haben, so sei die “Obsession mit der Bedrohung von außen” als ganze pathologisch. Nach lacanianischer Lesart fungieren Flüchtlinge als Objekt des Begehrens und der Angstprojektion: Europäer lagern ihre inneren Konflikte und Schwächen auf das Bild des gefährlichen Anderen aus. Žižek schreibt, dies verrate mehr über die Verunsicherung Europas als über die Geflüchteten selbst. Er warnt vor zwei Extremeinstellungen – der Angst-Hysterie einerseits und einer idealisierenden Verleugnung andererseits – und plädiert dafür, die echten sozioökonomischen Ursachen der Krisen (von globaler Ungleichheit bis Nachwirkungen des Kolonialismus) in den Blick zu nehmen. Žižeks polemischer Stil findet sich in Feuilletons ebenso wie in akademischen Sammelbänden – er verbindet Kulturtheorie, Marxismus und Psychoanalyse zu scharfen Gegenwartsdiagnosen.
Zienert-Eilts, K. J. (2020). Destructive populism as “perverted containing”: A psychoanalytical look at the attraction of Donald Trump. The International Journal of Psychoanalysis, 101(5), 971-991.
Die Autorin untersucht das Auftreten und die Entstehungsprozesse destruktiver populistischer Entwicklungen in der westlichen Welt aus einer psychoanalytischen Perspektive, anhand des Beispiels von Donald Trump und seinen Wählern. Sie entwirft die Grundzüge eines psychoanalytischen Erklärungsmodells für destruktive populistische soziale Prozesse. Sie veranschaulicht das Phänomen des »destruktiven populistischen Fits« zwischen Trump und seinen Anhängern durch eine Analyse von Donald Trumps gut dokumentierten Wahlkampagnen in den Jahren 2016 und 2020, ergänzt durch sein Handeln während der COVID-19-Krise im Jahr 2020. Für das psychoanalytische Verständnis der Wirksamkeit seiner Methoden und der Anfälligkeit der Wähler für destruktiven Populismus wendet sie Bions Modell des Containings in Verbindung mit Herbert Rosenfelds Konzept des destruktiven Narzissmus an und entwickelt das Konzept des »pervertierten Containings«: Im Zuge der Regression auf eine paranoid-schizoide Ebene werden aggressiv-destruktive und omnipotente Affekte idealisiert, während die Container-Funktion der demokratischen Gesellschaft zunehmend aufgelöst, verzerrt und schließlich pervertiert wird. Beta-Elemente werden nicht entgiftet und verarbeitet, sondern im Gegenteil angeheizt. Diese Dynamik führt zu einer permanenten Eskalation durch immer neue destruktiv-erregende Handlungen, um den symbiotisch-destruktiven Fit im Modus des destruktiven Narzissmus aufrechtzuerhalten.
Wirth, H. J. (2022). Gefühle machen Politik. Psychosozial-Verlag.
Gefühle haben großen Einfluss auf unser Handeln. Sie dienen als Motivationskraft und stiften in kollektiv geteilter Form Beziehung und Nähe zu anderen Menschen oder dienen der Abgrenzung von feindlichen Gruppen. Gefühle haben die Aufgabe, zu erkennen, was auf uns einwirkt, auszudrücken, was wir empfinden, und zu bewerten, was wir erkannt haben. In der Politik und in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen spielen Gefühle deshalb eine zentrale Rolle: Der affektive Furor, den der Populismus entfacht, bündelt ohnmächtige Wut, blinden Hass, Neid, Verbitterung und Rachewünsche zu Ressentiments, die das soziale Zusammenleben vergiften. Gefühle, die an der menschlichen Verletzbarkeit anknüpfen, wie etwa Besorgnis, Trauer, Mitleid, Empathie und Hoffnung, eröffnen hingegen die Chance auf alternative Perspektiven. An zahlreichen Beispielen aus aktuellen politischen Auseinandersetzungen erläutert der Autor, wie Gefühle politisches Handeln beeinflussen und wie mit Gefühlen Politik gemacht wird.
Fleury, C. (2023). Hier liegt Bitterkeit begraben: Über Ressentiments und ihre Heilung Suhrkamp Verlag.
Die politische Philosophie und die Psychoanalyse teilen ein Problem, das sowohl für das Leben der Menschen als auch für die Gesellschaft eine Gefährdung darstellt: die dumpfe Unzufriedenheit, diese Bitterkeit, die unter die Haut gehen kann – das Ressentiment. Die Philosophin und Psychoanalytikerin Cynthia Fleury begibt sich in ihrem gefeierten Buch auf die Suche nach den Ursprüngen und dem innersten Wesen des Ressentiments. Was können wir tun, um in unseren Demokratien dessen bedrohliche Impulse einzudämmen? Wie können wir Ressentiments heilen? Fleury taucht tief ein in die einschlägigen Überlegungen von Friedrich Nietzsche, Max Scheler, Sigmund Freud, Theodor W. Adorno und Frantz Fanon und entwickelt eine klinische Sichtweise: Für einen Patienten besteht das Ziel der Therapie nicht allein in Erkenntnis und Wissen, sondern in der Fähigkeit, durch das eigene Leiden hindurch wieder zum Handeln zu gelangen. Auf der Ebene kollektiver Prozesse des Ressentiments, die in unserer globalisierten Welt mit zunehmender Heftigkeit auftreten, steht das Verhältnis von Psyche und Politik im Zentrum: Der demokratische Rechtsstaat ist in dieser Perspektive nicht nur ein institutionelles Verfahren, sondern auch eine notwendige Form der »Fürsorge«, um zu verhindern, dass die Bürgerinnen in Ressentiments abgleiten.
Illouz, E. (2023). The emotional life of populism: How fear, disgust, resentment, and love undermine democracy. John Wiley & Sons.
Die israelisch-französische Soziologin Illouz analysiert den weltweiten Rechtsruck aus emotionssoziologischer und kulturtheoretischer Sicht. Sie argumentiert, dass populistische Politik gezielt vier Emotionen – Angst, Ekel, Ressentiment und identitäre “Liebe” – anruft und zur dominierenden Antriebskraft im politischen Prozess macht. Diese “Gefühlspalette” schaffe ein antagonistisches “Wir gegen Die”, spalte soziale Gruppen und untergrabe das Vertrauen in demokratische Institutionen. Insbesondere Angst erweist sich als Motor: Sie liefert die Motivation, immer neue Feindbilder zu benennen oder zu erfinden und hält Gesellschaften in einem Zustand permanenter Alarmbereitschaft. Illouz betont, dass Populismus reale Missstände (etwa ökonomische Abstiege der Arbeiterklasse) zwar benennt, aber in der Imagination übersteigert: “Fear provides compelling motivation to repeatedly name enemies as well as invent them… to shift politics to a state of permanent vigilance to threats, even at the price of suspending the rule of law.” So werden demokratische Normen wie Rechtsstaatlichkeit geschwächt, wenn kollektive Ängste zum politischen Dauermodus werden. Illouz’ Buch – erschienen bei Polity Press – verknüpft psychoanalytisch informierte Theorie (etwa Freuds Massenpsychologie und Elias’ Zivilisationstheorie) mit aktuellen Beispielen aus Europa (z.B. französische Rassemblement National, italienische Fratelli d’Italia) und den USA.
…
de Barros, T. Z. (2020). Identität, jouissance und Demokratie. Eine psychoanalytische Annäherung an den demokratischen und antidemokratischen Populismus. In Populismus, Diskurs, Staat (pp. 29-50). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
In einem Beitrag für den Sammelband “Populismus, Diskurs, Staat” unternimmt Zicman de Barros den Versuch, populistische Bewegungen aus Lacans Psychoanalyse heraus zu differenzieren. Ausgangspunkt ist ein Paradox beim politischen Theoretiker Ernesto Laclau: Dessen Hegemonietheorie verteidigt Populismus als demokratisches Projekt, erkennt aber zugleich, dass populistische Logiken ganz unterschiedlich – demokratisch oder antidemokratisch – ausfallen können. Zicman de Barros nutzt Konzepte wie jouissance (übersetzt etwa Genusssucht/Befriedigung) aus der Lacan’schen Theorie, um zu erklären, wie populistische Bewegungen lustvolle Identifikationen und Ausschlüsse erzeugen. So ließe sich theoretisch zwischen inklusive, demokratische Formen von Populismus (die “das Volk” offen definieren) und exklusive, autoritäre Formen (die auf Feindbilder und Ausgrenzung gründen) unterscheiden.
Figlio, K (2023): The Authoritarian Superego. Vortrag in der Reihe „Psychoanalysis and the Public Sphere: Authoritarianism“
In einem Vortrag argumentiert Figlio, Autoritarismus müsse als Prozess innerer Dynamik verstanden werden. Er knüpft an Freuds Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921) an: Darin beschreibt Freud, wie Gruppen entstehen, indem Individuen ihr Ich-Ideal (das innere Idealbild der eigenen Person) nach außen auf den Führer projizieren. Die Anhänger erheben also ihren Anführer zum gemeinsamen Ideal – er verkörpert, was jeder gerne sein würde. Gleichzeitig identifizieren sich die Gruppenmitglieder untereinander über diese gemeinsame Verehrung des Führers, was Freud als Massenbildung durch Identifizierung erklärt. Der Führer wird zum Mittelpunkt der Psyche der Gefolgsleute; er übernimmt gleichsam die Funktion eines Über-Ichs für die Gruppe. Figlio verbindet dies mit Freuds Das Ich und das Es (1923), wo Freud das Über-Ich als “Besetzungsstufe im Ich”bezeichnete Normalerweise repräsentiert das Über-Ich die verinnerlichten Werte und das Gewissen, oft geprägt durch Elternautoritäten. Im Falle eines autoritären Bewegungsführers kommt es zu einer Art kollektiver Über-Ich-Bildung: Die moralischen Maßstäbe und Verbote der Anhänger richten sich nach dem Willen des Führers aus. Figlio spricht von einer “Linie” des Über-Ich, die sich über Generationen konsolidieren kann – eine Tradierung autoritärer Werte, die mit Schuldgefühlen und Liebesverlust-Drohungen verknüpft ist. Das heißt: Die Gruppenkultur entwickelt einen strengen inneren Wächter, der jeden Zweifel am Führer mit Schuld und Angst beantwortet (“Wie konntest du nur an XY zweifeln – er will doch unser Bestes, du würdest uns alle verraten!”). Dieser innere Druck hält die Menschen in der Gruppe. Selbst wenn ein Mitglied leise Zweifel hegt, fürchtet es unbewusst die Bestrafung durch dieses innere autoritäre Über-Ich, das sich als Angst vor Liebesentzug der Gemeinschaft und als Schuldgefühl äußert. Dadurch werden „Abweichler“ emotional destabilisiert und oft zurück in die kollektive Einheit gezwungen. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt, den Figlio hervorhebt, ist die Rolle der Lüge in autoritären Beziehungen. Autoritäre Führer bedienen sich notorisch der Unwahrheit – ob durch Propaganda, Verzerrung oder komplettes Leugnen der Realität. Figlio stellt fest, dass diese bewussten Lügen des Führers paradoxerweise die Abhängigkeit der Anhänger verstärken. Indem der Führer nachweislich Falsches behauptet (z.B. eine Wahllüge oder Verschwörung) und die Gefolgschaft trotzdem daran festhält, wird ihre Loyalität auf die Probe gestellt und zugleich zementiert. Das Mitvollziehen der Lügewird zum Loyalitätsbeweis: Man zeigt, dass man dem Führer mehr glaubt als allen anderen Quellen – selbst den eigenen Augen. Zudem isolieren die Lügen die Gruppe von der Außenwelt (die ja „getäuscht“ sein soll). Ein aktuelles Beispiel ist Trumps “Big Lie” von der gestohlenen Wahl 2020: Obwohl Dutzende Gerichte keinerlei Beweise für massiven Betrug fanden, glaubt die Mehrheit seiner Anhänger weiterhin daran. Im September 2023 etwa meinten 63 % der republikanischen Wähler in den USA, Trump sei der rechtmäßige Sieger der Wahl 2020 (prri.org). Die Fakten spielen keine Rolle – wichtiger ist die demonstrative Loyalität zur behaupteten „Wahrheit“ des Anführers. Dadurch entsteht eine geradezu symbiotische Beziehung: Der Führer definiert die Realität, die Anhänger akzeptieren sie gehorsam, und je absurder die Behauptung, desto mehr trennt sie die Gläubigen von den „Naiven draußen“, was die Binnenloyalität weiter steigert.
Mcafee, N. (2024). Racists, Fascists, and Other Dejects: Authoritarianism Reconsidered. Conference Paper
In diesem Konferenzpapier knüpft Noëlle McAfee an The Authoritarian Personality (Adorno et al.) an und erweitert dessen Modell durch psychoanalytische Ansätze, insbesondere Julia Kristevas Theorie der Abjektion. McAfee untersucht, wie rassistische, sexistische oder faschistische Gruppen (die sie als dejects bezeichnet) ihre eigene unsichere Identität durch strikte Spaltung verteidigen: Bestimmte Merkmale oder Personengruppen werden als „abjektes“ Fremdes ausgegrenzt, um das „Eigene“ scheinbar zu reinigen und zu erhöhen. Anstatt sich mit ambivalenten Gefühlen auseinanderzusetzen, projizieren diese autoritären Persönlichkeiten ihre Ängste und Aggressionen nach außen und werten andere ab (etwa Migrant*innen, Schwarze Menschen, Frauen, queere Personen). McAfee nennt diese Haltung „dichotom und hierarchisch“, weil autoritäre Subjekte stets klare Feinde oder Sündenböcke konstruieren und das Eigene als makellos verklären. Sie zeigt außerdem, dass diese rigiden Spaltungen in einem grundlegenden psychischen Defizit wurzeln: Die Betroffenen empfinden eine tiefe Verunsicherung über ihre eigene Position in der Welt und sehen in der Hierarchisierung (etwa Rasse, Geschlecht, Nation) ein Mittel, Sicherheit und Identität zurückzugewinnen. So erklärt McAfee, warum Faschismus, Rassismus oder Sexismus untrennbar mit Angst und Abwehrmechanismen verbunden sind. Sie plädiert dafür, autoritäres Verhalten psychoanalytisch als „abjektes“ Denken zu begreifen: Ein Versuch, innere Widersprüche durch unbewusste Spaltung zu lösen, der aber letztlich zu anhaltender Feindseligkeit und politischen Verwerfungen führt.
Richards, B. (2024). The authoritarian/libertarian hybrid. Free Associations, (93).
Barry Richards untersucht das scheinbar widersprüchliche Zusammenwirken von autoritären und libertären Tendenzen in der heutigen Politik. Traditionell galten diese als diametral entgegengesetzte Pole: Auf der einen Seite beruht der Autoritarismus auf dem Primat einer Führungsfigur oder eines Dogmas und fordert die Unterordnung der Anhänger unter ein klar bestimmtes Feindbild. Auf der anderen Seite betont der Libertarismus die uneingeschränkte Handlungsfreiheit des Individuums und empfindet äußere Autoritäten als Einmischung oder Bedrohung. Richards zeigt jedoch, dass diese beiden Pole in der gegenwärtigen Phase kultureller „Flüssigkeit“ zu einem paradoxen Hybrid verschmelzen. Als Beispiele nennt er die Bewegung um Donald Trump, in der eine aufwieglerisch-libertäre Rhetorik (etwa gegen staatliche Regulierungen, für das individuelle Recht auf Waffenbesitz) mit einem quasi-sektiererischen Kult um den politischen „Retter“ zusammentrifft. Ähnliches beobachtet er in verschwörungstheoretischen Gruppen, die einerseits die Freiheit individueller Erkenntnis und alternativer Weltdeutungen propagieren, andererseits einem autoritären „Über-Ich“ folgen (etwa Trump als Held in der QAnon-Erzählung). Ein drittes Beispiel betrifft manche Strömungen in den Transgender-Debatten: Einerseits gilt die radikale Selbstbestimmung als Ausdruck libertärer Souveränität, andererseits treten strikte Regeln über zulässige Rede und einschneidende Maßnahmen gegen abweichende Positionen auf, was für Richards eine autoritäre Note hat. Um diesen scheinbaren Widerspruch zu erklären, beruft sich Richards auf psychoanalytische Erklärungsmodelle, insbesondere Erich Fromms Beschreibung der „Flucht in die Freiheit“ und Earl Hoppers Konzeption eines „core complex“. In beiden Ansätzen verweisen autoritäre wie libertäre Verhaltensweisen letztlich auf dieselben Grundängste, nämlich die Furcht vor Identitätsverlust und Ohnmacht. So ist das Streben nach totaler individueller Autonomie (libertär) ebenso eine Abwehrhaltung wie die kollektive Verschmelzung unter einer Führung (autoritär), nur dass im ersten Fall die Angst vor Vereinnahmung dominiert, im zweiten die Angst vor Isolation. Diese psychischen Mechanismen können ineinandergreifen und sich miteinander verschmelzen, wenn ein Teil der Gesellschaft scheinbar alles „aufbrechen“ will und zugleich einem charismatischen Anführer bedingungslose Gefolgschaft gewährt. Das Resultat dieser Verbindung – eine „autoritäre Freiheit“ oder „libertäre Strenge“ – ist für Richards politisch hoch wirksam. Sie verbreitet sich in sozialen Medien, breiten Verschwörungsbewegungen und ideologischen Debatten, indem sie einerseits verlockende Fantasien individueller Entgrenzung nähren, andererseits durch die Zugehörigkeit zu einer verschworenen Gemeinschaft Schutz, Identität und die Möglichkeit gewaltsamer Ausgrenzung Andersdenkender bieten. So führt das Hin und Her zwischen Autoritarismus und Libertarismus zu einer Destabilisierung des rationalen Diskurses und einer gesteigerten Spaltung der Gesellschaft, was die liberale Demokratie in besonderer Weise herausfordert. Richards sieht hierin eine destruktive Dynamik, die nur verstanden werden kann, wenn man erkennt, wie beide Pole tief im gleichen angstgetriebenen „Kernkonflikt“ wurzeln – ein Konflikt, der Menschen wahlweise zu kompromissloser Ablehnung jeder Vorschrift oder zur naiven Hingabe an einen vermeintlich allmächtigen Führer treibt.
Philipson, I. (2024). Displacement and the Rise of Left and Right Authoritarian States of Mind. Free Associations, (93).
Ilene Philipson untersucht in ihrem Aufsatz „Displacement and the Rise of Left and Right Authoritarian States of Mind“ (2024), wie Menschen in einer zunehmend chaotischen, ungleichen und von neoliberalem Denken geprägten Gesellschaft unbewusst Abwehrmechanismen nutzen, um ihre Ängste und Wut abzulenken. Sie greift dabei auf Freuds Begriff der „Verschiebung“ (displacement) zurück, interpretiert ihn jedoch nicht in dessen klassischem Sinn intrapsychischer Konflikte, sondern vor dem Hintergrund einer Welt, in der traditionelle Solidaritätsstrukturen (Familie, Religion, Gewerkschaften) geschwächt sind und die individuelle Sinnsuche immer schwieriger wird. Philipson schildert anhand zweier klinischer Beispiele, wie Patient:innen ihre Ohnmacht über wachsende soziale Prekarität, Gewalt und Orientierungslosigkeit in politische Überzeugungen umlenken, die scheinbar klare Feindbilder anbieten. So wendet sich etwa eine alleinerziehende Krankenschwester, die mit dem Auseinanderbrechen ihrer Familie und der alltäglichen Brutalität ihrer Arbeit im Notfallbereich konfrontiert ist, an Donald Trump und dessen Versprechen, „Amerika wieder groß zu machen“. Ein anderer Patient, der als Doktorand im geisteswissenschaftlichen Bereich kaum berufliche Perspektiven hat, fokussiert sich auf die Abwehr von Transphobie und vermeidet so, sein eigenes existenzielles Problem – den drohenden Verlust seines akademischen Lebenswegs – überhaupt anzuschauen. Derartige Verschiebungen, so Philipson, führen dazu, dass politische Wut sich nicht gegen die realen Ursachen – etwa die strukturelle Macht der neoliberalen Wirtschaftseliten – richtet, sondern an breiten, unscharf definierten Objekten wie „Critical Race Theory“ (für Rechte) oder „systemischer Rassismus“ (für Linke) ausgelassen wird. Der Effekt ist eine moralische Gewissheit, die beide Seiten in einen „autoritären Geisteszustand“ treiben kann: Wo auf der Rechten die „radikale Linke“ oder Einwanderer als Feindbilder herhalten, ist es auf der Linken mitunter die „unreine“ Position anderer Progressiver, die scharf verurteilt wird. Philipson argumentiert, dass solche ideologischen Kämpfe gegen abstrakte Ziele („Make America Great Again“, „Soziale Gerechtigkeit“) zwar emotionale Gemeinschaft stiften, aber keine konkreten Lösungen liefern. Die eigentlichen gesellschaftlichen Probleme – Einkommensungleichheit, sinkende Löhne, das Fehlen eines sozialen Netzes und die Dominanz des Großkapitals – bleiben dadurch unangetastet. Die Autorin schließt, dass der Hang zu solch polarisierenden Erklärungen eine Form unbewusster „Verschiebung“ ist: Menschen empfinden Angst und Hilflosigkeit angesichts einer zunehmend neoliberalen, von Geldwerten bestimmten Welt, und finden in erzählerisch einfachen, ideologisch aufgeladenen Deutungsmustern (links oder rechts) Identifikation und emotionalen Halt – ohne dass diese jedoch an den ökonomischen und politischen Grundstrukturen tatsächlich rütteln.
Olivier, B. (2021). Freud on group psychology and leaders: The case of Donald Trump. Psychotherapy and Politics International, 19(3), e1569.
Was kann Freud uns in Bezug auf die Grundlagen der „Führungsrolle“ lehren, die dem derzeitigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump zugeschrieben wird, wenn man bedenkt, dass eine solche „Führungsrolle“ das Vorhandensein einer erkennbaren „Gruppe“ voraussetzt, deren mutmaßlicher Anführer Trump ist? Es wird argumentiert, dass Freuds Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse von 1921 die begrifflichen Mittel liefert, um zu klären, in welchem Sinne Trump tatsächlich als „Führer“ beschrieben werden kann. Um dies darzulegen, werden die relevanten Passagen aus Freuds Essay rekonstruiert, wobei besonderes Augenmerk auf seinen Anspruch gelegt wird, dass die Konstitution einer Gruppe unauflöslich mit den „libidinösen Bindungen“ zwischen einem Anführer und seinen Anhängern verbunden ist – etwas, das Freud anhand zweier „organisierter“ Gruppen ausführt, nämlich der römisch-katholischen Kirche und der Armee. Freuds Auffassung über die einigende Rolle eines Führers in Bezug auf eine Gruppe sowie sein Hinweis, dass auch gemeinsamer Hass auf etwas, das außerhalb der Gruppe liegt, die Einheit stärken kann, werden daraufhin im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Trump und seinen Unterstützern untersucht, insbesondere in Bezug auf die republikanischen Mitglieder des US-Kongresses sowie seine „Basis“ in der Öffentlichkeit. Letztlich erweisen sich Freuds Beobachtungen zur „Identifikation“ als Schlüssel zum Verständnis dessen, in welchem Sinne Trump als „Führer“ gelten kann, vor allem jene Form der Identifikation, die mit dem Wunsch „etwas zu sein“ verbunden ist. Unter Rückgriff auf Naomi Kleins Analysen zu Trump werden Freuds Erkenntnisse auf die Frage angewandt, was es an Trump ist, womit sich seine Anhänger identifizieren. Insbesondere Kleins Hinweise auf den sadistischen Charakter von Trumps The Apprentice liefern den entscheidenden Anhaltspunkt dafür, die unbewussten Gründe für die Identifikation seiner Anhänger mit ihm zu formulieren: In dem Maße, in dem Trump eine „Kastration“ (Ohnmacht) oder einen Mangel „verleugnet“, verkörpert er eine imaginäre „Fülle des Seins“, mit der sie sich identifizieren.
Luks, G. (2024): Eros, Thanatos und Logos – Historisches und Gegenwärtiges zur Politischen Psychoanalyse. In: Bauriedl-Schmidt, C., Brockhaus, G., Busch, C., Fellner, M., Hutfless, E., Kaufhold, C., … & Zierl, J. (2024). Politische Psychoanalyse: Jahrbuch für klinische und interdisziplinäre Psychoanalyse Bd. 2. Brandes & Apsel Verlag.
In seinem Aufsatz „Eros, Thanatos und Logos – Historisches und Gegenwärtiges zur Politischen Psychoanalyse“ zeichnet Gregor Luks zunächst die Ursprünge und Entwicklungen einer Psychoanalyse nach, die nicht nur auf individuelle Analysen beschränkt ist, sondern auch gesellschaftliche Prozesse in den Blick nimmt. Angesichts gegenwärtiger globaler Krisen – vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bis hin zum jüngsten Terrorangriff der Hamas auf Israel – sieht er ein wachsendes Gefühl der Ohnmacht und Angst, dem psychoanalytische Konzepte wie Empathie, reflektierte Selbstkritik und Bewusstmachung unbewusster Dynamiken entgegengesetzt werden können. Er verweist auf zentrale Figuren der Politischen Psychoanalyse: Ernst Federn beispielsweise, selbst Holocaustüberlebender, beschrieb die „Bestialität“ des Menschen, verwies jedoch zugleich auf die Fähigkeit zur Überwindung von Gewalt. Sigmund Freud betonte in „Massenpsychologie und Ich-Analyse“ die libidinösen Bindungen, die eine Masse zusammenschweißen, und sah in „Eros“ (dem Liebes- und Bindungstrieb) und „Thanatos“ (dem Zerstörungs- oder Todestrieb) jene beiden grundlegenden Kräfte, die in jedem Menschen miteinander ringen. Totalitäre Systeme ermöglichten, so Freud, eine kollektive Regression in archaische Gewalt: Die Aggression werde nach außen projiziert, während zugleich eine Führerfigur mit „väterlicher“ Autorität bedingungslosen Gehorsam erzwingt. Wilhelm Reich thematisierte in „Die Massenpsychologie des Faschismus“ die Ausbeutung jener autoritätsorientierten Haltungen und betonte die Verbindung von Sexualunterdrückung, hierarchischer Familie und sadistischer Gewalt im Faschismus. Die Frankfurter Schule, vor allem Adorno und Horkheimer, nahm Freuds Einsichten auf und entwickelte die Autoritarismusforschung weiter; Erich Fromm war als Psychoanalytiker integraler Teil dieses Diskurses. Weitere Vertreter wie Paul Parin und das Ehepaar Mitscherlich (Alexander und Margarete) untersuchten, wie Gesellschaften nach totalitären Katastrophen wie dem Nationalsozialismus ihre Vergangenheit nur halbherzig aufarbeiteten und sich Verdrängungsmechanismen (etwa „Unfähigkeit zu trauern“) auf kollektiver Ebene zeigten. Gerade in Deutschland zeigte sich laut den Mitscherlichs eine Flucht in Wirtschaftswunder und Normalisierung, ohne die emotionale Dimension des NS-Terrors adäquat zu verarbeiten. Der psychoanalytische Blick verdeutlicht, dass unbewusste Schuld, Scham und Aggression sich in Formen von Geschichtsverdrängung oder in übertriebenen Feindbildern äußern können. Dieses Spannungsfeld zeigt sich auch in Russland: Nach zeitweiligen Phasen einer Entstalinisierung hat die Ära Putin zu neuerlichen Regressionstendenzen geführt, in denen sich nationalistische und imperiale Fantasien mit gezielter Propaganda verbinden, was letztlich in die gewaltsame Aggression gegenüber der Ukraine mündete. Der zeitgenössische Soldat Pawel Filatjew berichtet von der Haltlosigkeit und Unklarheit, die er beim Einmarsch in die Ukraine erlebte, während die russische Zivilgesellschaft, so Filatjew, in Angst und Gleichgültigkeit zunehmend verstumme. Eine ähnliches Bild zeichnet sich laut Psychoanalyse auch in anderen autoritären oder populistischen Bewegungen ab: Selbst „postmoderne“ Erscheinungen wie Querdenker-Proteste können auf regressiven Ohnmachtsgefühlen beruhen, die mittels Feindprojektionen und Spaltungsmechanismen (Splitting) kanalisiert werden. In der heutigen deutschsprachigen Psychoanalyse befassen sich etliche Autorinnen und Autoren – etwa Amlinger/Nachtwey mit dem „libertären Autoritarismus“ oder Kobylinska-Dehe/Dybel/Hermanns mit der Wiederkehr des Verdrängten – intensiv mit kollektiven Projektionen, Hass und Demokratiefeindlichkeit. Auch Horst-Eberhard Richter und Thomas Auchter sehen im permanenten Erinnern und Bewusstwerden der Schattenseiten (Wiederholungszwang, introjizierte Tyrannei, Abspaltungen) einen Weg, gesellschaftliche Aggression zu mindern. Zum Schluss schlägt Luks das Konzept eines „emotional-transzendenten Logos“ vor: Neben den Grundkräften Eros und Thanatos brauche es eine Vernunft, die sich nicht nur rational, sondern auch empathisch definiert. Damit könne man bewusst der kollektiven Regression entgegenwirken und der Verleugnung realer Konflikte mit einer reifen, gleichwohl gefühlsoffenen Vernunft begegnen. Luks plädiert dafür, dass dieser aufklärerische, zugleich emotionale Zugang – ähnlich Freuds Vision einer Verschränkung von Bewusstsein und Triebdynamik – die größte Chance bietet, in einer Welt voller Krisen eine destruktive Wiederholungsschleife zu durchbrechen und solidarische Selbstbestimmung zu stärken.
Brockhaus, G (2024): »Ratlos dastehen in der fremd gewordenen Welt« – Dilemmata psychoanalytischer Zeitdiagnosen in virulenten Krisen In: Bauriedl-Schmidt, C., Brockhaus, G., Busch, C., Fellner, M., Hutfless, E., Kaufhold, C., … & Zierl, J. (2024). Politische Psychoanalyse: Jahrbuch für klinische und interdisziplinäre Psychoanalyse Bd. 2. Brandes & Apsel Verlag.
In ihrem Beitrag beleuchtet Gudrun Brockhaus die Schwierigkeiten, in aktuellen und hochemotionalen Krisenzeiten – wie Krieg, Terror oder dem brisanten Umgang mit Klimawandel und Pandemien – zu fundierten psychoanalytischen Zeitdiagnosen zu gelangen. Ausgangspunkt ist Freuds Essay „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ (1915): Freud schildert darin bereits, wie schwer es ist, ein tobendes Gewaltgeschehen zu analysieren, wenn man selbst mitten im Strudel der Ereignisse steht und an Parteiungen oder kollektiven Ängsten teilhat.
Brockhaus zeigt, dass auch heute die gewaltige Dynamik mehrerer gleichzeitiger Krisen (Coronapandemie, Ukrainekrieg, Israel-Gaza-Konflikt, Klimanotstand) die psychoanalytische Forschung vor enorme Herausforderungen stellt. Zugleich beobachtet sie eine „Diskursvergiftung“: Schuldzuweisungen, extreme Moralisierungen und Feindbildkonstruktionen zerstören wechselseitiges Vertrauen und untergraben jede tiefere Verständigung.
Im ersten Schritt verdeutlicht die Autorin, wie sich psychoanalytische Abstinenz gegenüber Zeitfragen historisch erklären lässt (etwa durch Professionalisierung in der Medizin, wie Paul Parin kritisierte). Doch mittlerweile sind die gegenwärtigen Krisen so einschneidend, dass eine reine Rückhaltung für Analytiker kaum mehr möglich ist. Dennoch bleibt es schwierig, weil sich jede Recherche und jedes Urteil im gefährlich aufgeheizten Affektklima bewegen, wo Schwarz-Weiß-Denken, Freund-Feind-Schemata und ideologische Kampfbegriffe dominieren.
Ein zentraler Punkt ist Freuds Sicht, dass Krieg immer zu Entzivilisierung und Regression führt: In einem Kampf verschieben sich moralische Grenzen; Hass, Lüge und Brutalität werden erleichtert. Brockhaus überträgt dieses Motiv auf heutige Debatten: Das wütende Moralisieren, die aggressive Abwertung des Gegners und das Bestreben, die eigene Einschätzung als einzig richtige Wahrheit zu proklamieren, bedeuten eine ähnliche „Verrohung“ des Denkens, die auch die Forschenden erfasst. Man versucht, das Chaos mit psychoanalytischer Diagnostik (etwa pathologisierende Etikettierungen) zu bändigen. Doch dabei droht eine verkürzende Psychologisierung, die gewaltige politische Machtlogiken unzureichend erfasst und manchmal selbst in Feindzuschreibungen mündet (z. B. „böse“ oder „verrückt“).
Zudem finden sich starke Sehnsüchte nach Eindeutigkeit und moralischer Gewissheit: Wer die jeweilige Krise nicht als „höchste Dringlichkeit“ anerkennt oder anders priorisiert, wird schnell als irrational oder unmoralisch gebrandmarkt. Brockhaus zeigt exemplarisch, wie im Umgang mit der Klimakrise viele Aktivisten eine kompromisslose Evidenz beanspruchen („The Science“), was die Ambiguitätstoleranz weiter mindert. In den Kriegen wiederum greift rasch pauschales Feinddenken, das differenzierendes Verstehen ablehnt (etwa die Beschuldigung, ein „Putinversteher“ oder „Terrorversteher“ zu sein).
Letztlich formuliert Brockhaus, dass die eigentliche Stärke der Psychoanalyse gerade in der Akzeptanz unbewusster, auch aggressiv-destruktiver Anteile bestehen sollte, anstatt in moralischer Überlegenheit. Freuds „Enttäuschung des Krieges“ mache deutlich, wie Scheinheiligkeit und Verleugnung eigener aggressiver Potenziale zu einer bürgerlichen Fassungslosigkeit führen, sobald massive Gewalt plötzlich Realität wird. Anstelle moralischer Anklagen oder einfacher Psychopathologie-Vorwürfe bedürfe es also der Einsicht, dass in jedem Menschen zerstörerische Triebregungen existieren, die im Ausnahmezustand rasch aktiviert werden können. Gerade diese kritische Selbstreflexion und das Bewussthalten von Ambivalenzen könnten eine analytische Auseinandersetzung mit „virulenten Krisen“ ermöglichen, ohne dass man sich blind von der Emotionalisierung mitreißen lässt oder in entwertende Freund-Feind-Schemata verfällt.