Reform der Psychotherapeutenausbildung in Deutschland – Stand März/April 2025
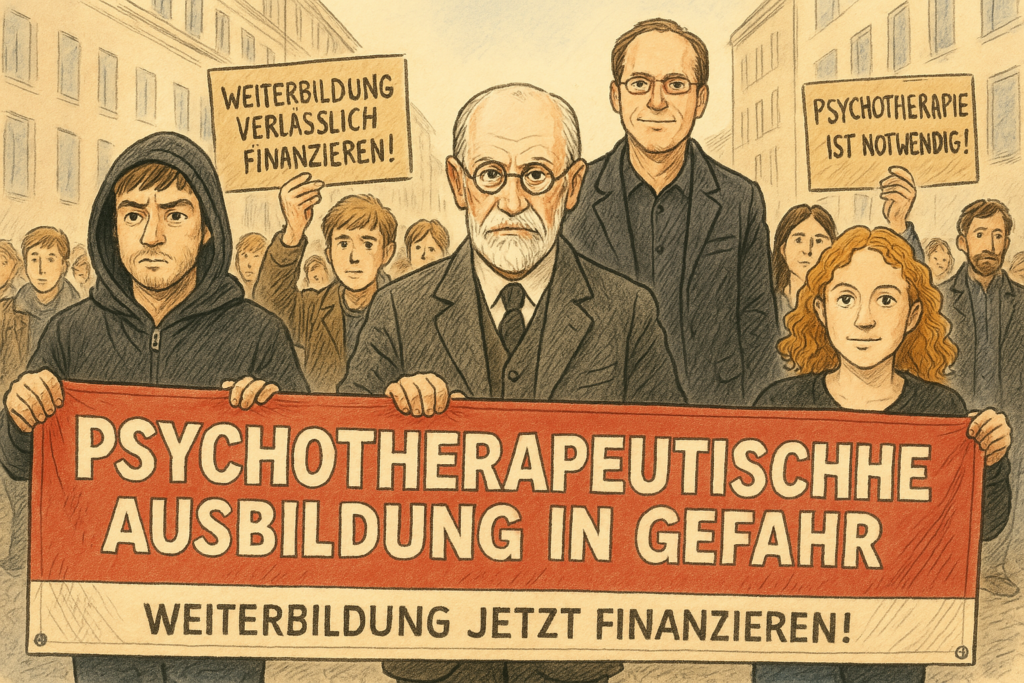
Quellen: Gesundheitsministerium,
1. Historische und politische Entwicklung der Reform
Die Reform der Psychotherapeutenausbildung wurde 2019 mit dem Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz (PsychThGAusbRefG) auf den Weg gebracht . Auslöser war die Kritik am alten Ausbildungssystem: Nach dem Psychologie-Studium mussten angehende Psychotherapeut*innen eine kostspielige, oft unbezahlte Ausbildung absolvieren (PiA-System), was als unzeitgemäß galt . Unter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) legte die Bundesregierung 2019 den Gesetzentwurf vor. Am 26. September 2019 beschloss der Bundestag das Reformgesetz mit breiter Mehrheit ; der Bundesrat stimmte im November 2019 zu. Das neue Psychotherapeutengesetz trat zum Herbst 2020 in Kraft und leitete einen grundsätzlichen Wandel ein: Psychotherapie wurde ein eigenständiges fünfjähriges Universitätsstudium (3 Jahre Bachelor + 2 Jahre Master) mit anschließender staatlicher Approbationsprüfung . Bei bestandener Prüfung erhalten Absolvent*innen die Approbation als Psychotherapeut*in. Damit ist erstmals der Direktzugang zum Heilberuf geschaffen.
Wichtige Meilensteine folgten in den Jahren danach. 2020 wurde die Approbationsordnung für Psychotherapeut*innen (PsychThApprO) neu gefasst, welche Inhalte des Studiums und der Prüfung regelt. 2021 griff der Gesetzgeber erste Nachbesserungen auf: Im Rahmen des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) wurde festgelegt, dass Ausbildungsinstitute einen Vergütungsanteil von mindestens 40 % der von PiA bzw. PiW erbrachten Leistungen an diese weitergeben müssen . Außerdem wurde für die Übergangs-PiA eine Mindestvergütung von 1.000 € pro Monat während der praktischen Tätigkeit eingeführt – ein Novum, da zuvor keine Bezahlung vorgeschrieben war. Diese Änderungen sollten die prekären Bedingungen der alten Ausbildung abmildern.
Nach Regierungswechsel Ende 2021 übernahm die Ampel-Koalition (SPD, Grüne, FDP) das Thema. Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach (SPD) kündigte an, die offenen Finanzierungsfragen zu klären. Im Jahr 2023 wuchs der Druck: Der Bundesrat forderte in einer Entschließung im September 2023 die Bundesregierung auf, die Finanzierung der neuen Weiterbildung gesetzlich abzusichern . Die Koalition integrierte entsprechende Regelungen in das geplante Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG), ein Gesetzespaket zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune. Doch die politischen Umstände verhinderten den Abschluss: Interne Konflikte der Ampel-Koalition führten Ende 2024 zu einer Koalitionskrise, die schließlich zum Bruch der Regierungskoalition führte . Der Bundestag wurde vorzeitig aufgelöst – eine seltene Situation – und Bundespräsident Steinmeier setzte Neuwahlen für den 23. Februar 2025 an . In der kurzen verbliebenen Zeit verabschiedete der Bundestag nur eine abgespeckte Version des GVSG ohne die vorgesehenen Regelungen zur Psychotherapie-Weiterbildung . Damit blieb die Finanzierungsfrage zunächst ungelöst. Die historische Entwicklung der Reform ist somit von wechselnden politischen Konstellationen geprägt: Die Grundsatzreform 2019 wurde noch unter Großer Koalition beschlossen, die Ausgestaltung der Weiterbildung jedoch geriet 2023/24 zwischen die Räder einer Regierungs- und Staatskrise.
Zeitliche Meilensteine der Reform
2017–2018
Wachsende Kritik am PiA-System; Verbände und Studierende fordern Reform (Petitionen, Stellungnahmen)
Jan. 2019
Referentenentwurf des BMG für das PsychThGAusbRefG veröffentlicht; Anhörungen mit Fachverbänden
26.09.2019
Bundestag verabschiedet das PsychThGAusbRefG (Neufassung PsychThG, Direktstudium mit Approbation)
08.11.2019
Bundesrat stimmt zu; Gesetz wird im Bundesgesetzblatt verkündet (Jg. 2019, Teil I Nr. 46)
01.10.2020
Inkrafttreten des neuen Psychotherapeutengesetzes ; Start der neuen Bachelor/Master-Studiengänge
Juni 2021
GVWG: Einführung der 40 %-Vergütungsregel und 1.000 € PiA-Mindestgehalt
2022
BPtK erarbeitet Muster-Weiterbildungsordnung; Länder beginnen mit Umsetzung in Landesrecht
Sept. 2023
Bundesrat fordert Bundesregierung zur Finanzierung der Weiterbildung auf
Okt.–Nov. 2024
Beratungen zum GVSG im Bundestag; öffentliche Anhörung am 13. 11. 2024 . Proteste der PiA/PiW begleiten den Prozess.
Dez. 2024
Koalitionsbruch der Ampel ; Gesetzgebungsstau. GVSG wird kurz vor der Wahl 2025 nur noch in Teilen verabschiedet (Finanzierungsregelungen entfallen)
Feb. 2025
Vorgezogene Bundestagswahl am 23. 02. 2025 . Neues Parlament und Regierungsbildung stehen bevor; offene Punkte der Reform müssen erneut aufgegriffen werden
Diese Chronologie verdeutlicht, wie ein zunächst planmäßig verlaufender Reformprozess durch politische Umbrüche ins Stocken geraten ist. Trotz breitem Konsens über die Notwendigkeit der Reform blieb insbesondere die Ausgestaltung der Weiterbildungsphase bis Anfang 2025 unvollendet – mit erheblichen Auswirkungen, wie die folgenden Abschnitte zeigen.
2. Beteiligte Akteure und Interessengruppen
An der Gestaltung und Diskussion der Reform sind zahlreiche Akteure beteiligt. Fachverbände der Psychotherapeutinnen und Psychologinnen, Kammern, Studierendenvertretungen sowie Gewerkschaften nehmen Einfluss:
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK): Als Standesvertretung aller Psychotherapeut*innen formuliert die BPtK offizielle Stellungnahmen und berät Politik und Ministerium. Sie begrüßte die Reform grundsätzlich, mahnte aber von Beginn an die Finanzierung der Weiterbildung an. BPtK-Präsidentin Dr. Andrea Benecke warnte zuletzt eindringlich: „Wir steuern mit voller Wucht auf einen Fachkräftemangel in der Psychotherapie zu, wenn die Finanzierung der ambulanten und stationären Weiterbildung nicht umgehend gesetzlich gesichert wird“ . Die BPtK forderte drei Maßnahmen: eine bedarfsgerechtere Bedarfsplanung, bessere Versorgungsangebote für schwer psychisch Kranke und die Finanzierung der Weiterbildung . In der politischen Debatte tritt die Kammer als Sachverständige auf (etwa in Bundestagsanhörungen) und liefert Daten zur Versorgungslage.
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung (DPtV): Größter Berufsverband niedergelassener und angestellter Psychotherapeutinnen (mit ~25.000 Mitgliedern). Die DPtV engagiert sich besonders für angemessene Vergütung und Arbeitsbedingungen. Sie fordert seit Jahren eine tarifliche Eingruppierung von Psychotherapeutinnen analog zu Fachärztinnen. Konkret unterstreicht die DPtV die ver.di-Forderung, approbierte Psychologische Psychotherapeutinnen (PP) und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen (KJP) im öffentlichen Dienst in Entgeltgruppe 15 einzugruppieren . Für Psychotherapeutinnen in Weiterbildung (PiW) hält sie mindestens EG 14 für „unumgänglich“ , da deren Tätigkeit dem Facharztstandard entspreche. DPtV-Bundesvorsitzender Gebhard Hentschel betont: „Die Entgeltgruppe 14 für Psychotherapeutinnen in Weiterbildung ist unumgänglich“* . Neben Gehältern setzt sich die DPtV auch für Qualitätsstandards in der Weiterbildung ein (Supervision, Selbsterfahrung, begrenzte Patientenzahl; siehe Abschnitt 3). Auf Landesebene ist die DPtV mit Landesgruppen aktiv und hat etwa bei den Landesgesundheitsministerien die Doppelapprobation hinterfragt. Ergebnis: In manchen Bundesländern ist es rechtlich möglich, nach neuem Masterabschluss zusätzlich die alte Ausbildung zu durchlaufen (und so eine Doppelapprobation als PP und KJP zu erlangen), in anderen nicht. Bayern und Hamburg haben beispielsweise klargestellt, dass eine Doppelapprobation nicht zulässig ist . Dagegen erlauben etwa Berlin, Hessen, Niedersachsen oder NRW dies unter bestimmten Bedingungen (Übergangsrecht: Studienbeginn vor 1.9.2020) . Die uneinheitlichen Landesregelungen erzeugen Verunsicherung bei Absolvent*innen, ob und wo sie ggf. noch in die alte Ausbildung wechseln können.
Fachverbände der Ausbildungsinstitute: Organisationen wie die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT), die Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) und der Verband der analytischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (VAKJP) vertreten spezifische Ausbildungsträger und Therapieschulen. Sie bringen ihre Perspektiven in die Gesetzgebung ein – etwa die DGVT mit Forderungen nach ausreichend ambulanten Weiterbildungsplätzen (sie hält mindestens 1.500ambulante Weiterbildungsstellen bundesweit für notwendig) . Auch die DGPT und VAKJP achteten darauf, dass die Reform die verschiedenen Psychotherapieverfahren (Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, Psychoanalyse etc.) angemessen berücksichtigt. So forderten die Grünen 2019 auf Anraten dieser Fachkreise, dass im Studium die Behandlung aller Altersgruppen und ein breites Spektrum von Methoden gelehrt werden müsse . Die Institute stehen nun vor der Aufgabe, eigene Weiterbildungsstätten gemäß neuem Recht aufzubauen. Ihre Verbände drängen auf klare Rahmenbedingungen, um den Betrieb finanzieren zu können. Sie warnen davor, dass ohne zusätzliche Mittel viele Institute keine Weiterbildungsplätze anbieten können.
PiA-/PiW-Vertretungen und Studierendeninitiativen: Diejenigen, die die Reform direkt betrifft – Psychotherapeutinnen in Ausbildung bzw. künftig in Weiterbildung – haben sich lautstark Gehör verschafft. Die Psychologie-Fachschaften-Konferenz (PsyFaKo e.V.) bündelt die Interessen der Psychologie-Studierenden und neuen Masterstudierenden Psychotherapie. Sie informiert, organisiert Proteste und formuliert Forderungen gegenüber der Politik. Gemeinsam mit dem im Herbst 2023 gegründeten Forum für Psychotherapeutinnen in Weiterbildung (PtW-Forum) machte die PsyFaKo auf die Finanzierungslücke aufmerksam. Zahlreiche lokale PiA-Initiativen (z.B. PiA-Vertretungen an Universitäten oder Ausbildungskliniken) und Netzwerke (wie das PiA-Forum) trugen ebenfalls den Protest mit. Sie fordern eine vollständige Finanzierung der Weiterbildung, damit nicht erneut eine „Generation Schulden“ aus unbezahlten oder schlecht bezahlten Ausbildungskandidatinnen entsteht. Zudem setzen sie sich für faire Arbeitsbedingungen ein: z.B. Anrechnung der Arbeitsleistung in der Weiterbildung auf das Stundendeputat, planbare Arbeitszeiten und kostenfreie Supervision. Die Stimmung unter den Nachwuchs-Psychotherapeutinnen wurde 2024 zunehmend angespannt, wie Lena Jäger (Sprecherin der PsyFaKo) in einem Positionspapier schrieb: „Ohne eine Finanzierung können wir unser Berufsziel nicht erreichen – das ist frustrierend und alarmierend zugleich“ (sinngemäß).
Gewerkschaften: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di engagiert sich für die tarifliche Einstufung von Psychotherapeutinnen. Innerhalb von ver.di existiert seit 2016 eine Bundesfachkommission für PP/KJP, die die Angleichung an die Ärztetarife fordert . Ver.di unterstützt die Forderung nach EG 15 für approbierte Psychotherapeutinnen im öffentlichen Dienst und EG 14 für PiW . Gewerkschafterinnen wiesen zudem auf die Gefahr hin, dass gut ausgebildete Psychotherapeutinnen ohne angemessene Bezahlung Kliniken verlassen oder gar nicht erst dort anfangen – was den Fachkräftemangel verschärft . Neben ver.di haben auch andere Arbeitnehmervertretungen (etwa Marburger Bund für die ärztlich tätigen Psychotherapeuten in Kliniken) die Lage im Blick. Allerdings waren ver.di und DPtV in den letzten Tarifrunden noch nicht erfolgreich, EG 14/15 flächendeckend durchzusetzen – vielerorts fehlen ja überhaupt erst die Stellen, um die es gehen würde.
Insgesamt ziehen alle Interessengruppen an einem Strang, was die Kernanliegen angeht: Klare Finanzierung, ausreichende Plätze und faire Vergütung. Unterschiede liegen im Fokus: Die BPtK argumentiert stark über die Auswirkungen auf die Patientenversorgung; die DPtV und Gewerkschaften betonen die arbeitsrechtliche Gleichstellung mit Ärzten; die Studierenden machen mit Aktionen öffentlichen Druck und schildern ihre persönliche Notlage. Die Fachverbände achten darauf, dass ihre Mitglieder (Institute, Therapeut*innen bestimmter Schulen) nicht benachteiligt werden – z.B. durch Mitspracherechte bei der Weiterbildungsgestaltung. Trotz teilweise unterschiedlicher Perspektiven haben Verbände und PiA/PiW-Vertreter im Reformprozess eng kooperiert, um gemeinsam Verbesserungen zu erreichen (etwa bei Protesten, siehe unten). Dies erklärt, warum die Probleme der Reform so breit bekannt wurden und politisch auf der Agenda blieben.
3. Gründe für aktuelle Probleme in der Weiterbildungsphase
Trotz der gelungenen Studienreform haben sich in der praktischen Weiterbildungsphase erhebliche Probleme gezeigt. Hauptursache ist die fehlende finanzielle Grundlage der neuen Weiterbildung. Das Gesetz von 2019 ließ offen, wer die fünfjährige postgraduale Weiterbildung bezahlen soll . Anders als bei Ärztinnen (deren Facharztausbildung in Kliniken regulär vergütet wird) wurde für Psychotherapeutinnen kein klares Finanzierungsmodell etabliert. Die Folge: Kliniken, Ambulanzen und Praxen zögern, Weiterbildungsstellen einzurichten, da unklar ist, wie sie die Gehälter der PiW refinanzieren können . Krankenkassen verweisen darauf, dass sie bereits die erbrachten Leistungen vergüten und nicht zusätzlich in der Pflicht seien . Die Weiterbildungsinstitute wiederum sind meist private oder universitär angebundene Einrichtungen ohne größere eigene Mittel. Solange keine gesetzlichen Vorgaben existieren, schiebt also jeder Akteur die Verantwortung von sich – ein klassischer Finanzierungsstau. Die “40%-Regelung” aus dem GVWG 2021 sollte Abhilfe schaffen, greift aber zu kurz. Sie besagt, dass ambulante Weiterbildungsstätten mindestens 40 % der Honorare für von PiW erbrachte Therapien an diese auszahlen müssen . Doch 40 % von üblichen GKV-Sätzen decken oft nicht ein volles Gehalt. Die DPtV kritisierte, hier würden Ausbildung (PiA) und Weiterbildung (PiW) gleichbehandelt, obwohl PiW bereits approbierte Heilberufler sind, die wesentlich produktiver mitarbeiten . Selbst wenn Institute 40 % abgeben, können PiW-Gehälter deutlich unter Tarifniveau bleiben. Zudem beziehen sich die 40 % nur auf Ambulanzen der Institute, nicht auf Weiterbildungsstellen in Kliniken oder Praxen. Insgesamt fehlt ein Mechanismus, der gesamte Kosten der Weiterbildung abdeckt (Gehalt plus Sozialabgaben, sowie Kosten für Supervision und Theorie).
Mangel an Weiterbildungsplätzen: Aufgrund der Finanzierungsunsicherheit wurden bislang viel zu wenige Stellen geschaffen. Zahlreiche Absolventinnen, die 2023/24 ihren Master und die Approbationsprüfung abgeschlossen haben, fanden keine Weiterbildungsstelle und mussten ihre Karriere aufschieben . In Berlin/Brandenburg etwa warteten Ende 2023 rund 50 neue Psychotherapeutinnen “auf Halde” . Bundesweit könnten 2024 bereits ca. 1.000 Absolvent*innenbetroffen sein, und ab 2025 sogar bis zu 2.500 pro Jahr, schätzt die BPtK . Diese Zahlen zeigen das drohende Ausmaß: Wenn nicht schnell Plätze entstehen, baut sich ein gewaltiger Rückstau an Nachwuchskräften auf. Viele von ihnen wären nötig, um die Versorgung zu sichern (siehe Abschnitt 4), können aber ihren Beruf nicht ausüben. Ein zynischer Effekt ist zudem, dass ein Teil der Absolvent*innen versucht, doch noch in die alte Ausbildung zu wechseln (über die Übergangsregelung), um wenigstens über den bekannten Weg zur Abrechnungsgenehmigung zu kommen. Das jedoch führt zur skurrilen Situation einer Doppelapprobation (neues Studium + alte Ausbildung), was – wie oben erwähnt – nicht überall erlaubt ist und langfristig nicht gewollt sein kann. Dieser Umweg wird nur deshalb erwogen, weil der neue Weiterbildungsweg versperrt scheint.
Unklare Vergütungsmodelle: Selbst die wenigen Pionierstellen für PiW, die 2024 geschaffen wurden, zeigen ein uneinheitliches Bild. Einige Universitätskliniken oder Ambulanzen haben PiW befristet angestellt, orientieren sich mangels Vorgaben aber an unterschiedlichen Tarifen. Während etwa in Pilotprojekten ein Gehalt nach TVöD EG 14 in Aussicht gestellt wurde, liegen andere Angebote deutlich darunter . Teils wurde PiW nur EG 13 oder weniger angeboten, was der Qualifikation (Approbation als Heilberufler) eigentlich nicht entspricht. In privaten Einrichtungen gibt es gar keine Tarifbindung, hier drohen noch niedrigere Löhne. Die Gewerkschaft ver.di warnte, ohne feste Eingruppierung bestehe die Gefahr eines „Billig-Tarifs“ und Abwanderung von Fachkräften . Besonders problematisch: Einige Weiterbildungsstätten verlangen von PiW, dass sie Teile der Kosten selbst tragen – analog zur alten PiA-Praxis. So berichten PiW, dass ihnen z.B. die Stunden der erforderlichen Selbsterfahrung in Rechnung gestellt werden oder sie die Gebühr für theoriegeleitete Kurse bezahlen sollen. Einheitliche Standards fehlen bisher. Die DPtV fordert, dass zumindest die Kosten für Supervision von den Weiterbildungsstätten übernommen werden, da ohne Supervision keine fachgerechte Behandlung durch PiW möglich ist . Bislang gibt es aber keine verbindliche Regelung hierzu, sodass jede Einrichtung ihre eigenen (oft ungünstigen) Bedingungen festlegt.
Fehlende Standards und Struktur: Auch jenseits der Finanzen ist die neue Weiterbildungslandschaft inhomogen. In manchen Bundesländern existieren noch keine Weiterbildungsordnungen oder -gesetze, weil die Landesgesetzgebung Zeit braucht. So hatten bis 2024 nicht alle Länder eine Zuständigkeit geklärt, wer etwa die Weiterbildungsermächtigungen erteilen darf. Ohne klare rechtliche Struktur können Weiterbildungsstellen schwer eingerichtet werden. Zudem besteht Unsicherheit über den genauen Ablauf: Gibt es am Ende der Weiterbildung eine Prüfung? (Die Musterordnung der BPtK sieht ein kollegiales Fachgespräch vor, aber Gesetz und Approbationsordnung schweigen dazu.) Viele Absolvent*innen zögern daher, ins Ungewisse zu starten und schieben den Approbationsabschluss hinaus . Laut DPtV haben etliche Studierende bewusst ihr Masterzeugnis oder die Prüfung verzögert, „aufgrund der unsicheren Situation in der Weiterbildung“ . Dies erklärt, warum die Zahl der Approbationsprüfungen 2024 weit hinter den Erwartungen blieb.
All diese Probleme kumulierten im Herbst 2024 in einer Welle von Protesten. Im Oktober 2024 fanden in mehreren Städten Demonstrationen statt, organisiert von PsyFaKo, PiA/PiW-Netzwerken und unterstützt von Berufsverbänden. Vor dem Bundestag in Berlin demonstrierten rund 400 Personen am 16. 10. 2024 lautstark für eine Lösung . Auf Schildern war zu lesen: „Ohne Finanzierung keine Therapie“, „Weiterbildung statt Warteschlange“ oder „Psychotherapie in Gefahr“. Zeitgleich gingen in Hamburg etwa 600 Menschen auf die Straße , in Bamberg über 200 . Die Protestierenden – Studierende, Neuapprobierte, aber auch etablierte Therapeutinnen – machten deutlich, dass ohne rasche politische Reaktion ein ganzer Berufsnachwuchs verloren gehen könnte . Die Aktionen fanden Gehör: Vertreterinnen der Verbände erhielten Einladung zu Gesprächen im Gesundheitsministerium, und im Gesundheitsausschuss des Bundestags wurden die Forderungen vorgetragen . Doch der politische Stillstand durch die Koalitionskrise konterkarierte diese Bemühungen schließlich . Mit dem Scheitern des GVSG-Endspurts im Dezember 2024 war klar: Bis auf Weiteres bleibt die Finanzierungslücke bestehen, und die Protestbewegung kündigte an, in der neuen Legislatur weiterzukämpfen .
Die aktuellen Probleme resultieren daraus, dass die groß angelegte Reform nicht bis zu Ende gedacht bzw. umgesetzt wurde. Ein fehlendes Finanzierungskonzept, Verantwortungsgeschiebe zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern, zu wenige Weiterbildungsplätze und keine einheitlichen Standards – dieses Bündel an Versäumnissen führte zu einer Krise, die sich nun deutlich zeigt. Die nächste Regierung wird diese Punkte dringend angehen müssen, um das Reformprojekt zu vollenden und den Kollaps der psychotherapeutischen Nachwuchsförderung abzuwenden.
4. Auswirkungen auf Ausbildung und Versorgung
Die beschriebenen Schwierigkeiten haben spürbare Folgen – sowohl für die Betroffenen in der Ausbildung als auch für das Gesundheitssystem insgesamt.
Auf die Ausbildungsgänge: Zunächst zeigt sich ein deutlicher Knick in der Nachwuchsgewinnung. Obwohl seit Winter 2020/21 zahlreiche Universitäten den neuen Psychotherapie-Master anbieten und inzwischen mehrere Kohorten das Studium abgeschlossen haben, kommen nur wenige Absolventinnen tatsächlich im neuen System an. Die Landesprüfungsämter rechneten für Herbst 2024 mit ca. 300 Approbationsprüfungen nach neuem Recht – statt der ursprünglich erwarteten ~1.000 . Tatsächlich haben bis Ende 2024 nur sehr wenige (deutlich unter 300) die Prüfung abgelegt und die Approbation erhalten. Nach Angaben der BPtK waren bis Dezember 2024 lediglich 131 Personen mit neuer Approbation Mitglied einer Psychotherapeutenkammer; davon hatten nur 15 bereits eine Weiterbildung begonnen . Diese Zahlen sind alarmierend niedrig. Viele Master-Absolventinnen wichen, wie erwähnt, in die Übergangsausbildung aus (sofern sie vor 1.9.2020 ihr Studium begonnen hatten) . Jene, die diese Option nicht haben, stehen nun vor der Wahl, entweder abzuwarten oder ins Ausland zu gehen bzw. in anderen Berufsfeldern tätig zu werden. Einige zieht es beispielsweise in die Forschung oder Beratung, bis die klinische Weiterbildung geklärt ist. Dadurch droht dem Reformziel – jährlich Hunderte neue Psychotherapeut*innen auszubilden – vorerst eine Verfehlung. Experten erwarten allerdings, dass ab 2026/27 deutlich mehr Studierende gezwungenermaßen ins neue System gehen (dann greifen keine Übergangsregelungen mehr) . Sollte bis dahin die Struktur nicht funktionsfähig sein, könnte es schlagartig zu noch größeren Engpässen kommen.
Die Qualität der Ausbildung gerät ebenfalls in den Fokus. Unter den jetzigen Bedingungen besteht die Gefahr, dass PiW – falls sie denn eine Stelle finden – überlastet werden oder ihre Weiterbildung nur eingeschränkt absolvieren können. Wenn beispielsweise aus Finanzgründen die nötige Selbsterfahrung hintenangestellt oder auf eigene Kosten in der Freizeit gemacht wird, fehlt diese wichtige Selbsterkenntnis-Komponente im Arbeitsalltag. Auch unzureichende Supervision (etwa weil Supervisor*innen nicht bezahlt werden) kann die Qualität der therapeutischen Leistungen mindern. Die DPtV betont, dass PiW nicht mehr als etwa 20 Therapiesitzungen pro Woche übernehmen sollten, um genügend Zeit für Reflexion und Lernen zu haben . In wirtschaftlichem Druck könnten Einrichtungen aber versucht sein, PiW als vollwertige Behandlungskräfte einzusetzen, was eine Überforderung darstellen würde. Solche Entwicklungen wären schlecht für die Ausbildung und letzten Endes auch für die Patienten.
Auf die Patientenversorgung: Mittelfristig sind Auswirkungen auf die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland absehbar. Schon jetzt ist die Lage angespannt: „Hohe Prävalenzen, steigender Versorgungsbedarf, fehlende Behandlungskapazitäten und unzumutbar lange Wartezeiten“prägen die Situation seit Jahren . In ländlichen Regionen und für bestimmte Gruppen (Kinder, Jugendliche, Schwerstkranke) fehlen Therapieplätze besonders . Diese Versorgungslücke könnte sich noch vergrößern, wenn der Nachwuchs ausbleibt. Die BPtK prognostiziert, dass bis 2030 die Nachfrage nach Psychotherapie um 23 % steigt, während gleichzeitig rund ein Drittel der aktuell praktizierenden Psychotherapeutinnen das Rentenalter erreicht . Ohne genügend neue Therapeutinnen droht also ein eklatanter Fachkräftemangel. Genau dieses Szenario wird nun wahrscheinlicher, da der Ausbildungsstau durch die Reformprobleme den Zustrom neuer Behandler hemmt. BPtK und andere warnen: „Der sich zuspitzende Engpass muss umgehend abgewendet werden“ , da sonst Patienten noch länger auf Therapie warten oder unversorgt bleiben.
In Zahlen lässt sich der Ausbildungseinbruch so beschreiben: Früher (altes System) schlossen pro Jahr etwa 1.200–1.500 PiA ihre Ausbildung ab und erhielten die Approbation als PP oder KJP. Diese Zahl ging 2022/23 zunächst nicht stark zurück, da noch viele im Übergang waren. Doch 2024 ff. kommen aus dem alten System immer weniger (denn der Studierenden-Nachwuchs ging ja ins neue Studium). Wenn nun aus dem neuen Studium nur wenige nachrücken, entsteht eine Lücke. Schon 2025 könnten hunderte Kassensitze unbesetzt bleiben, weil keine oder zu wenige fertige Psychotherapeut*innen nachrücken. Erste Anzeichen: In einigen Regionen, z.B. ostdeutschen Bundesländern, melden Kassenärztliche Vereinigungen vermehrt freie Sitze mangels Interessenten. Zwar ist dies auch bislang ein Problem (geringe Zulassung in ländlichen Räumen), aber der Nachwuchsmangel könnte es verschärfen.
Zudem hat die Unklarheit über die Weiterbildung Einfluss auf das Motivationsklima unter Studierenden. Einige berichten von Enttäuschung und Existenzängsten nach dem Master: „Meine Situation ist wirklich beschissen. […] Ich möchte unbedingt als Psychotherapeut anfangen zu arbeiten. Aber wo und wie, weiß keiner“, schilderte einer der ersten Masterabsolventen der FU Berlin im Oktober 2023 frustriert . Solche Stimmen könnten künftig auch potentielle Studienbewerber abschrecken, was langfristig zu weniger Nachwuchs führen würde. Bisher ist Psychotherapie zwar ein begehrtes Studium, doch ohne Aussicht auf eine anschließende qualifizierte Weiterbildung droht ein Attraktivitätsverlust des Berufs.
Positiv zu vermerken ist, dass es 2024 erste Modelllösungen gab, die zumindest lokal Entlastung schaffen sollten. In Rheinland-Pfalz, Hamburg und Sachsen initiierten die Kassenärztlichen Vereinigungen und Landesministerien sogenannte Förderprogramme: Praxen, die einen PiW beschäftigen, erhalten finanzielle Zuschüsse (analog zur Förderung von Landärzten) . Diese Leuchtturmprojekte sollen die ambulante Weiterbildung ankurbeln. Allerdings sind es nur wenige Dutzend Stellen, und bis eine bundeseinheitliche Lösung kommt, bleibt es Stückwerk. Einige Universitätskliniken haben ebenfalls Planstellen für PiW eingerichtet, um den stationären Teil der Weiterbildung abzudecken – oftmals in Erwartung, dass Gesetzgeber oder Länder die Refinanzierung regeln. Hier greifen Kliniken teils auf eigene Budgetmittel zurück, was nicht unbegrenzt möglich ist.
In der ambulanten Versorgung müssen bis zur Klärung interimistisch oft Übergangslösungen her: Etwa beschäftigen Praxisinhaber die neuen Kolleg*innen als „Berater“ oder in befristeten Projekten, um ihnen Tätigkeiten zu ermöglichen, die nicht voll der Regelversorgung entsprechen. Solche Notlösungen können jedoch die Qualitätskontrolle erschweren.
Zusammengefasst: Die Stockungen in der Weiterbildungsreform wirken bereits dämpfend auf den Zustrom neuer Psychotherapeut*innen und könnten in wenigen Jahren deutlich zum Fachkräftemangel beitragen. Dies wiederum hätte zur Folge, dass psychisch kranke Menschen noch längere Wartezeiten ertragen müssten und Versorgungslücken größer werden – eine Entwicklung, die in Zeiten steigenden Bedarfs fatal wäre. Noch sind die unmittelbaren Auswirkungen 2025 begrenzt (da es einen Überhang aus dem alten System gibt), aber ohne Nachsteuerung droht ab 2026/27 eine Verschärfung. Es steht also nicht weniger als die zukünftige Versorgungssicherheit in der Psychotherapie auf dem Spiel.
5. Positionen von Parteien und politischer Entscheidungsprozess
In der politischen Diskussion herrscht grundsätzlich Einigkeit, dass die Reform der Psychotherapeutenausbildung notwendig war – Uneinigkeit besteht aber in einigen Detailfragen und der Prioritätensetzung. Ein Blick auf die Positionen der Parteien und den Verlauf im Bundestag: Bei der Verabschiedung des PsychThGAusbRefG 2019 trugen die Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD den Gesetzentwurf gemeinsam. In der Debatte lobten Redner der GroKo die Modernisierung des Berufsbildes. Die Opposition stimmte der Reform überwiegend zu, brachte aber eigene Anträge ein. So forderte Die Linke schon damals, die prekären PiA-Verhältnisse umgehend zu beenden und sicherzustellen, dass es keine unbezahlten Ausbildungskandidaten mehr gibt . Bündnis 90/Die Grünen mahnten eine Finanzierung der ambulanten Weiterbildung an, analog zur Förderung der Allgemeinmedizin (Hausärzte-Programm) . Ein entsprechender Grünen-Antrag verlangte explizite Zuschüsse für die Weiterbildung sowie Übergangsregelungen für alle, die noch im alten System steckten . Diese Oppositionsanträge fanden 2019 keine Mehrheit, doch ihre Inhalte sollten später erneut relevant werden. In der 20. Wahlperiode (2021–2025) lag die Verantwortung bei der Ampel-Koalition. Im Koalitionsvertrag 2021 bekannten sich SPD, Grüne und FDP zur Reform und kündigten an, offene Fragen zu klären (die Formulierung blieb allgemein, nannte aber die Versorgung psychisch Kranker als Schwerpunkt). Praktisch zeigte sich dann, dass insbesondere die SPD und Grünen im Parlament auf Tempo drängten: Der SPD-Gesundheitspolitiker Dirk Heidenblut (selbst Psychotherapeut) setzte sich lautstark für eine Finanzierungslösung ein. Die Grünen brachten ihre Expertise aus den 2019er Forderungen ein. Widerstände gab es eher auf administrativer Ebene – Finanzministerium und Gesundheitsministerium mussten eine Kostenverteilung entwickeln, was angesichts knapper Kassen und vieler Gesundheitsbaustellen (Pflege, Krankenhausreform) ins Hintertreffen geriet. Die FDP zeigte sich zwar offen für pragmatische Lösungen, wollte aber keine neuen „Bürokratiemonstren“ oder rein staatliche Finanzierungstöpfe schaffen. Hinter den Kulissen wurde offenbar um das „Wie“ gerungen: Eine Variante war z.B. ein Förderfonds, in den Bund, Länder und Kassen einzahlen – dies scheiterte jedoch am Zuständigkeitswirrwarr. Oppositionsparteien in dieser Phase, allen voran CDU/CSU, nutzten das Thema, um auf Versäumnisse der Regierung hinzuweisen. Im Juni 2023 brachten sie den Antrag „Versorgung von Menschen in psychischen Krisen stärken“ (BT-Drs. 20/8860) in den Bundestag ein . Darin forderten sie u.a. explizit, die Finanzierung der psychotherapeutischen Weiterbildung sicherzustellen. Dieser Antrag deckte sich inhaltlich stark mit den Forderungen der Fachverbände und wurde von der BPtK ausdrücklich begrüßt . Auch Die Linke und AfD befassten sich in Anfragen mit dem Thema (die AfD hatte z.B. bereits 2019 gefordert, die Studienzeit zu verlängern und ein Praxisjahr einzuführen ; in der Finanzierungslücke bezog sie allerdings keine klar konstruktive Position und stimmte später dem CDU/CSU-Antrag teils zu). Bündnis 90/Die Grünen wiederum, nun Teil der Regierung, konnten viele ihrer früheren Forderungen intern einbringen – was man am Entwurf des GVSG 2024 sah: Dort war tatsächlich eine Finanzierung analog zur ärztlichen Weiterbildung vorgesehen (u.a. mit Förderprogrammen für Praxen und einer Deckelung der Patientenbelastung der PiW) . Diese Punkte stammten im Wesentlichen aus grünen und SPD-Ideen, während die FDP eher darauf pochte, bestehende Gelder (Kassenhonorare) umzuschichten statt neue aufzulegen. Die politische Blockade entstand weniger aus inhaltlicher Gegnerschaft, sondern aus Zeit- und Prioritätenmangel sowie der Koalitionskrise. Bis Herbst 2024 hatte die Ampel-Regierung mehrere große Gesundheitsgesetze parallel auf dem Tisch (u.a. Krankenhausreform, Digitalisierung, Pflegeentlastung), wodurch das GVSG mit der Psychotherapie-Frage erst spät bearbeitet wurde. Als es endlich in die entscheidende Phase ging (Herbst 2024), brach die Koalition auseinander – „Der Bruch der Koalition hat dann alle Bemühungen vorerst zunichte gemacht“, so bilanziert es die DPtV enttäuscht . Die Verbände hatten bis zuletzt an die Regierungsfraktionen appelliert, zumindest die Psychotherapie-Regelungen noch vor der Wahl zu verabschieden . Doch daraus wurde nichts. Dieser Ablauf sorgte parteiübergreifend für Frust: Ampel-Politiker verwiesen auf den abrupten Abbruch ihrer Initiativen, die Opposition kritisierte die Koalition, es überhaupt so weit kommen zu lassen.
Nach der Bundestagswahl 2025 wird das Thema voraussichtlich erneut aufgegriffen. Je nach Koalitionsbildung könnte die Herangehensweise variieren, doch alle demokratischen Parteien haben im Wahlkampf signalisiert, dass sie die Psychotherapeutenausbildung weiter verbessern wollen. Sollte es bspw. zu einer Regierung unter Führung der Union kommen, ist zu erwarten, dass deren Antrag 20/8860 als Grundlage dient – dieser enthielt bereits viele konkrete Lösungsvorschläge (etwa Budgets für 1.000 Weiterbildungsplätze jährlich, die über die GKV finanziert werden). SPD und Grüne würden in einer Regierungsbeteiligung sicher darauf drängen, die im GVSG-Entwurf vorgesehenen Maßnahmen eins zu eins umzusetzen. Die FDP dürfte Wert darauf legen, dass Lösungen effizient und kostenbewusst sind (etwa befristete Anschubfinanzierungen statt dauerhafter neuer Posten). Landesregierungen spielen ebenfalls eine Rolle: Einige Länder haben angekündigt, notfalls eigene Förderprogramme aufzulegen, falls der Bund nicht handelt. So hat z.B. Bayern’s Gesundheitsministerium Ende 2024 prüfen lassen, ob aus dem Landeshaushalt Mittel für PiW-Stellen an bayerischen Unikliniken bereitgestellt werden können (dies geschah auf Druck des dortigen Landtags, der einen parteiübergreifenden Beschluss dazu fasste).
Die Verbände und Kammern bleiben im politischen Dialog aktiv. In Stellungnahmen betonen sie immer wieder, dass es keine parteipolitische Frage sei, sondern eine gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit, die Versorgung psychisch Kranker zu sichern . Deshalb sucht man Allianzen über Parteigrenzen hinweg. Bemerkenswert war z.B., dass bei der Anhörung zum GVSG im November 2024 sowohl ein grüner Experten (Felix Kiunke, neuapprobierter Psychotherapeut) als auch die Vertreterin der Bundesärztekammer und ein CDU-Abgeordneter alle die Finanzierungslücke ansprachen – mit ähnlich lautenden Forderungen nach Nachbesserung . Dieses Maß an Übereinstimmung ist ungewöhnlich in der Gesundheitspolitik. Grundsätzliche Haltungen zu Gesundheits- und Versorgungsfragen spiegeln sich auch hier wider: Parteien, die traditionell eine Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge befürworten (SPD, Grüne, Linke), betonen den staatlichen Auftrag, für genügend Therapeut*innen zu sorgen, und sind bereit, dafür gezielte Fördermittel einzusetzen. Marktliberalere Kräfte (FDP, teils CDU) möchten Lösungen möglichst im bestehenden System aus Selbstverwaltung und Eigenverantwortung finden – etwa durch moderate Anpassungen der Vergütungsströme statt großer Fonds. Allerdings hat die Dramatik der Lage offensichtlich ein Umdenken begünstigt: Selbst die CDU/CSU schlug in ihrem Antrag vor, Bundesmittel bereitzustellen, um die Weiterbildung anzukurbeln . Diese Flexibilität lässt hoffen, dass in der neuen Legislatur konkrete Maßnahmen parteiübergreifend getragen werden können.
Zusammengefasst stehen die politischen Sterne nicht schlecht, dass die Reform-Probleme erkannt und angegangen werden. Die Blockaden der Vergangenheit lagen weniger im Ob als im Wann und Wie. Nun, da das Thema – auch dank lautstarker Verbände und Proteste – prominent auf der Agenda ist, wird keine Partei das Anliegen ignorieren können. Es besteht eher die Herausforderung, in den kommenden Verhandlungen tragfähige Kompromisse zu finden, die sowohl die Finanzierung sichern als auch die unterschiedlichen Ideologien bedienen (staatliche Anschubhilfe vs. nachhaltige Selbstverwaltungslösung). Ein Scheitern an parteitaktischen Grabenkämpfen kann man sich angesichts der Versorgungskrise kaum leisten.
6. Stimmung, Ausblick und Prognosen
Die Stimmung unter den Beteiligten ist derzeit eine Mischung aus Anspannung, Ernüchterung, aber auch kämpferischer Entschlossenheit. Bei den Betroffenen – den angehenden Psychotherapeutinnen – herrscht viel Unsicherheit und Frust. Wie bereits geschildert, fühlen sich viele Absolventinnen “hängengelassen” und sehen ihre berufliche Zukunft bedroht. Zitat eines Absolventen: „Ich bin top ausgebildet […] möchte unbedingt arbeiten. Aber wo und wie, weiß keiner.“ . Solche Aussagen sind kein Einzelfall. In sozialen Netzwerken und offenen Briefen schildern PiW ihre Lage teils dramatisch: Von existenziellem Druck, weil nach dem Studium das Bafög endet und keine Stelle in Sicht ist; vom Gefühl, „in der Warteschleife“ zu hängen, wie es ein PsyFaKo-Papier nannte. Gleichzeitig ist aber auch eine bemerkenswerte Solidarität und Aufbruchsstimmung spürbar: Die Protestbewegung hat viele junge Psychotherapeutinnen vernetzt und politisiert. Statt resigniert abzuwarten, organisieren sie Demos (zuletzt am 22. März 2025 in München, mit mehreren hundert Teilnehmern ) und suchen das Gespräch mit Entscheidungsträgern. Diese Mobilisierung hat Expertinnen beeindruckt. So schrieb die ÄrzteZeitung Ende 2024 anerkennend, die Psychotherapie-Profession erlebe einen “Generationenwechsel in der Berufspolitik” – die Jungen artikulieren ihre Interessen lautstark und öffentlich, was es so früher kaum gab.
Die Berufsverbände unterstützen diese Aktionen und bringen ihre Expertise ein. Die DPtV betonte nach den gescheiterten GVSG-Verhandlungen: „Wir werden die Forderungen an die Politik weiter vortragen – im Wahlkampf, zu den Koalitionsverhandlungen, bei der neuen Regierung!“ . Diese kämpferische Ankündigung zeigt, dass man den Druck hochhalten will. Auch die BPtK macht in Pressemitteilungen deutlich, dass die Thematik 2025 oberste Priorität hat, egal wer regiert. Dr. Benecke (BPtK) äußerte die Erwartung, dass „gleich zu Beginn der neuen Legislatur ein Finanzierungskonzept beschlossen werden muss, um den drohenden Versorgungsengpass abzuwenden“. Sollte dies nicht passieren, rechnet die Kammer in den Folgejahren mit einem spürbaren Einbruch in der Versorgung (siehe Zahlen in Abschnitt 4) – ein Risiko, das politisch niemand verantworten möchte.
Experteneinschätzungen für 2026/2027: Allgemein prognostizieren Fachleute, dass 2026 ein Wendepunkt sein wird. Warum? Bis dahin können letzte Kohorten noch das alte Ausbildungssystem abschließen. Ab 2026/27 allerdings stehen quasi ausschließlich die neuen Absolventinnen bereit, die auf die PiW-Weiterbildung angewiesen sind . Wenn bis dahin keine tragfähige Struktur etabliert ist, werden Hunderte (ja, perspektivisch Tausende) ausgebildete Psychotherapeutinnen „in der Luft hängen“. Das würde den Fachkräftemangel mit Ansage herbeiführen. „Wir rennen sehenden Auges in einen Fachkräftemangel […] und das müssen wir unbedingt verhindern“, warnte Christina Jochim, Vorstandsmitglied der DPtV, schon Ende 2023 . Die Fachcommunity ist sich daher einig: Spätestens 2025/26 muss politisch nachgesteuert sein, damit 2026 nicht das große Chaos eintritt.
Positiv gesehen, bietet 2025 als Jahr des Neustarts (neue Regierung) auch eine Chance, Dinge neu anzugehen. So könnte ein eigenständiges Psychotherapeuten-Weiterbildungs-Fördergesetzerlassen werden – ein Weg, den manche Experten vorschlagen, um das Thema aus dem Schatten anderer Reformen herauszulösen. Alternativ könnte im Rahmen einer größeren Gesundheitsreform (Stichwort: Ambulantisierung, neue Bedarfsplanung) ein Paket geschnürt werden, das die Finanzierung regelt. Sollte eine Koalition mit Beteiligung von SPD und Grünen zustande kommen, ist denkbar, dass diese das ambulante Weiterbildungsstipendium aus dem GVSG-Entwurf direkt umsetzen. Bei einer Unions-geführten Regierung könnte ein pragmatischerer, vielleicht zunächst befristeter Fördermechanismus kommen (ähnlich dem von der Union vorgeschlagenen 1.500-Stellen-Programm ).
Übergangsweise sind auch Nachbesserungen in der Selbstverwaltung denkbar: Zum Beispiel könnten Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenkassen auf Bundesebene zusätzliche Vergütungszuschläge für von PiW erbrachte Leistungen vereinbaren, die faktisch ein höheres Gehalt ermöglichen. Ebenso könnten Berufsverbände und Gewerkschaften versuchen, in Tarifverhandlungen (TVöD oder Haustarife) schon vorsorglich bessere Konditionen für PiW festzuschreiben, um attraktive Stellen zu schaffen. Solche Maßnahmen würden zumindest punktuell die Lage verbessern und wären ein Signal an den Nachwuchs.
Von Seiten der Psychotherapieverbände wird auch über strukturelle Weiterentwicklungen nachgedacht. Eine Idee ist die Einrichtung von Weiterbildungsverbünden: regionale Netzwerke aus Kliniken, Praxen und Instituten, die gemeinsam PiW ausbilden, ähnlich den Weiterbildungsverbünden in der Allgemeinmedizin. Das könnte Synergien schaffen und die Finanzierung auf mehrere Schultern verteilen. Einige Modellprojekte dazu laufen bereits (z.B. in Baden-Württemberg in Kooperation mit der Landespsychotherapeutenkammer). Wenn diese erfolgreich sind, könnten sie als Blaupause dienen. Auch wird diskutiert, ob langfristig die psychotherapeutische Weiterbildung – analog zur Ärzteschaft – kammergestützt und mit einer Abschlussprüfung gestaltet werden sollte. Die BPtK hat bereits 2022 eine Muster-Weiterbildungsordnung beschlossen, die in vielen Länderkammern übernommen wurde . Diese sieht eine 5-jährige Weiterbildung mit curricularen Inhalten, Supervision und Praxiszeiten vor. Sollte diese Ordnung überall in Kraft treten und finanziell unterlegt werden, hätte man eine stabile Grundlage wie bei den Ärzte-Fachrichtungen.
Die derzeitige Stimmung schwankt also zwischen Sorge und Hoffnung. Sorge, weil alle Beteiligten die Brisanz der Lage erkennen und wissen, dass ohne Eingreifen ein Kollaps droht. Hoffnung, weil durch das gesteigerte Problembewusstsein und den politischen Neustart eine realistische Chance besteht, dass die Fehlstellen der Reform geschlossen werden. Immerhin gibt es – anders als oft in der Gesundheitspolitik – keinen lautstarken Widerstand gegen die notwendigen Änderungen; es geht „nur“ um das Wie. Fachleute wie Prof. Rainer Richter (ehem. BPtK-Präsident) schätzen die Perspektive so ein: „2025/26 werden wir Nachbesserungen sehen, das steht außer Frage. Die spannende Aufgabe wird sein, den Übergang so zu gestalten, dass weder Qualität noch Quantität leiden“. Er und andere warnen jedoch: Sollte die Politik wider Erwarten zögern oder uneins bleiben, hätte dies 2027 sichtbare negative Folgen – dann nämlich wären viele Therapieplätze unbesetzt und die Wartezeiten noch länger. Für die Studierenden und PiW bedeutet der Ausblick: Sie müssen sich vermutlich noch gedulden, aber das Jahr 2025 könnte die entscheidenden Weichen stellen. In der Zwischenzeit versuchen Verbände und engagierte Kliniker, übergangsweise so viele Stellen wie möglich zu schaffen (z.B. durch Umwidmung von Psychologen-Stellen in Kliniken zu PiW-Stellen). Auch persönliche Übergangslösungen werden diskutiert, etwa Tätigkeiten im Rahmen von bereits bestehender Versorgung (wie Anstellung in Institutsambulanzen auf anderen Positionen) – alles mit dem Ziel, die Zeit bis zur endgültigen Klärung zu überbrücken, ohne die Betroffenen zu verlieren.
Prognose: Die Zeichen stehen auf Änderung in 2025. Wahrscheinlich wird eine Kombination von Finanzspritzen und strukturellen Anpassungen kommen. Bis diese greifen, bleibt die Stimmung angespannt. Doch die breite öffentliche Aufmerksamkeit (viele Medien berichteten 2024 über die „Reform in der Sackgasse“) und der Schulterschluss der Profession machen durchaus Mut. Es dürfte allen Verantwortlichen klar geworden sein, dass hier ein dynamischer, gesellschaftlich relevanter Veränderungsprozess nicht stehen bleiben darf. Spätestens 2026 sollte – so die einhellige Expertenmeinung – das System so nachgebessert sein, dass die ersten größeren Kohorten von PiW regulär ihre Weiterbildung durchlaufen können. Gelingt dies, wird die Reform mittelfristig doch noch ihr Ziel erreichen, nämlich den Beruf attraktiver und zukunftssicher zu machen. Gelingt es nicht, käme auf das Gesundheitswesen eine erhebliche Krise zu. Der Druck und die bisherigen Signale lassen jedoch vermuten, dass das Pendel Richtung Lösungsfindung ausschlagen wird.