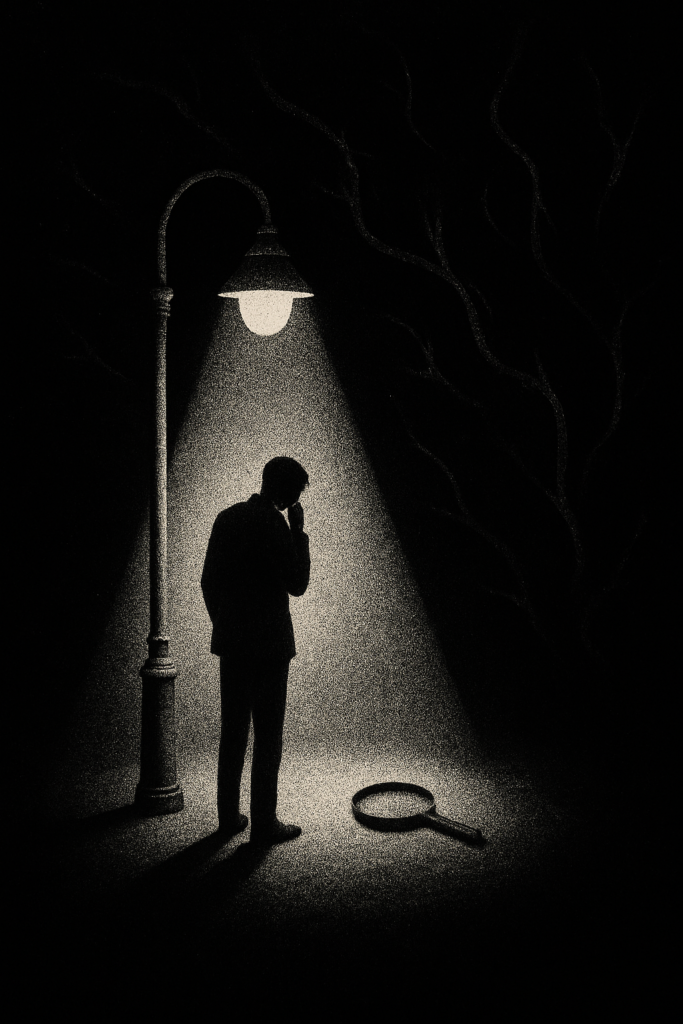
Die Psychoanalyse als Theorie und Praxis der Erkenntnis des Unbewussten stellt in der Wissenschaftslandschaft ein epistemologisches Sonderformat dar. Bereits Sigmund Freud (1895, 1900) beanspruchte für seine „Entdeckung des Unbewussten“ eine radikale Neubestimmung psychologischer Erkenntnis: Alle bisherigen Fragestellungen müssten angesichts des verborgenen Seelenanteils neu formuliert werden, und die Erforschung dieses Unbewussten verlange Methoden, die vom experimentellen Wissenschaftsbetrieb abweichen. Tatsächlich bemerkte Freud (1930) in einem Schreiben, dass es „innerhalb der Methoden unserer Arbeit keinen Platz [gibt] für die Art von Experiment, wie sie Physiker und Physiologen durchführen“. Diese früh proklamierte Eigenart der psychoanalytischen Methodologie – das Beharren darauf, dass die Psyche nicht in direkter empirischer Versuchsanordnung, sondern nur in der Hermeneutik von Bedeutungen und Fehlleistungen verstanden werden könne – hat eine bis heute andauernde Debatte ausgelöst: Handelt es sich bei der Psychoanalyse um eine erklärende Naturwissenschaft (mit Ursache-Wirkungs-Modellen) oder um eine verstehende Geisteswissenschaft (mit Deutung von Sinnzusammenhängen)? Oder geht sie als „dritte Säule“ einen eigenen Weg jenseits dieser Dichotomie?
Gerade diese Frage nach Erklären vs. Verstehen und Hermeneutik vs. Empirie (vgl. Dilthey, 1883; Windelband, 1894; sowie neuere Diskussionen bei Habermas, 1968/1973; Plessner, in diversen anthropologischen Schriften; Lorenzer, 1972, 1986) bildet den Hintergrund, vor dem die Psychoanalyse häufig als Grenzgängerin zwischen Wissenschaftskulturen diskutiert wurde. So sah etwa Jürgen Habermas (1968/1973) in ihr ein einzigartiges Beispiel einer empirisch fundierten, aber selbstreflexiv-hermeneutischen Wissenschaft, die auf Einsicht und Emanzipation abzielt. Hans-Georg Gadamer (1960) betonte demgegenüber die Verwurzelung jedes Verstehens in dialogischer Hermeneutik und Tradition – Aspekte, die auch das psychoanalytische Setting (Übertragung, Deutungsgespräch) prägen. Kritiker wie Adolf Grünbaum (1984) insistierten darauf, dass Freud durchaus kausale Hypothesen über seelische Vorgänge aufstellte, die an den Gütemaßstäben der empirischen Wissenschaften zu messen seien – und dass die klinischen „Belege“ dafür logischen und suggestiven Verzerrungen unterliegen könnten. Zwischen diesen Polen – wissenschaftlichem Erklären und verstehendem Interpretieren – loteten weitere Denker die Position der Psychoanalyse aus: etwa Paul Ricœur (1965) mit der Idee einer „Hermeneutik des Verdachts“ (wobei Freud neben Marx und Nietzsche zu den Meistern des Tieferlegens verborgener Sinnschichten zählt), oder Alfred Lorenzer (1986), der die psychoanalytische Erkenntnis als szenisches Verstehen unbewusster Interaktionsmuster beschrieb. Jacques Lacan (1964/1978) betonte die sprachliche Struktur des Unbewussten und führte der Psychoanalyse strukturalistische und dialektische Perspektiven zu, während neuere Autoren wie Giovanni Vassalli (2001) Freuds Texte dahingehend analysierten, dass Psychoanalyse weder eine gewöhnliche Naturwissenschaft noch reine Hermeneutik sei, sondern eher einer negativen Erkenntniskunst entspreche.
Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden die psychoanalytische Erkenntnistheorie unter dem Leitbegriff der „negativen Hermeneutik“ beleuchtet werden. Unter negativer Hermeneutik verstehen wir eine hermeneutische Praxis, die sich dezidiert auf das Unverfügbare, Verdrängte, Widerständige und Nicht-Symbolisierte richtet – also auf all das, was sich der bewussten Verständigung entzieht und doch als Negativspur in Sprache, Verhalten und Beziehung wirksam ist. Diese Perspektive soll zum einen theoretisch entfaltet und mit zentralen Begriffen untermauert werden. Am Ende soll deutlich werden, worin die erkenntnistheoretische Eigenart der Psychoanalyse als Wissenschaft vom Unbewussten besteht und weshalb sie in gewissem Sinne immer eine negative Hermeneutik bleiben muss.
Psychoanalyse zwischen Erklären und Verstehen: Wissenschaftstheoretischer Rahmen
Die Frage, ob Psychoanalyse eher erklärt (im Sinne kausalmechanistischer Naturerklärung) oder versteht (im Sinne sinnverstehender Geisteswissenschaft), ist so alt wie die Disziplin selbst (vgl. Freud, 1895, 1900; Dilthey, 1883; Windelband, 1894). Freuds Ausbildung als Neurologe und sein naturwissenschaftlicher Gestus führten zunächst dazu, dass er seine Theorien in Analogie zu Biologie und Physik formulierte – man denke an den psychischen Apparat, an energetische Konzepte wie Libido oder an die Anleihen bei der Thermodynamik (Konzept der Triebstauung und Abfuhr). Diese abstrakten Modelle fasste Freud u. a. in „Die Traumdeutung“ (Freud, 1900), den „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ (1905) und den „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ (1917) zusammen, später auch in den sogenannten „Metapsychologischen Schriften“ (Freud, 1915). Metapsychologie meint dabei ein Bündel von Betrachtungsweisen (dynamisch, ökonomisch, topisch), mit denen psychische Vorgänge zugleich nach antreibenden Kräften, energetischer Quantität und inneren Schauplätzen beschrieben werden sollten (vgl. Verhaeghe, 2002). In klassisch wissenschaftstheoretischer Lesart wäre dies ein nomothetischer Anspruch: Psychoanalyse sucht allgemeine Gesetzmäßigkeiten seelischer Abläufe (das Strukturmodell Ich-Es-Überich, Entwicklungsdynamiken wie den Ödipuskomplex) und formuliert Kausalthesen (z. B. dass unverarbeitete infantile Konflikte neurotische Symptome verursachen).
Gleichzeitig ist aber unübersehbar, dass Freuds Vorgehen immer auf Deutung von Bedeutungen beruhte. Seine berühmten Fallgeschichten (etwa Dora, Der kleine Hans, Der Rattenmann) lesen sich wie dichte hermeneutische Interpretationen, in denen verstehend rekonstruiert wird, was die jeweilige Symptomatik des Patienten bedeutet oder welche unbewusste Botschaft sich in Träumen und Fehlleistungen ausdrückt (vgl. Freud, 1905). Damit steht Freud in einer Tradition, die eher an die Geisteswissenschaften anschließt (vgl. Dilthey, 1883): Es geht um das Verstehen individueller Lebensgeschichten und Sinnzusammenhänge, nicht um experimentelle Überprüfbarkeit isolierter Variablen. Der Gegensatz von Erklären und Verstehen, den Windelband (1894) für Natur- versus Geisteswissenschaft aufgestellt hatte, scheint also in der Psychoanalyse auf. Tatsächlich argumentierte Habermas (1968/1973), die Psychoanalyse sei eine Doppelnatur: Empirie und Hermeneutik griffen ineinander, da die Therapie zugleich empirisch (auf reale Leiden bezogen und an Wirksamkeit messbar) und interpretativ (auf Einsicht und Selbstverstehen zielend) sei. Habermas spricht von einem emanzipatorischen Erkenntnisinteresse: Der Patient soll durch das Verstehen seiner unbewussten Determinanten Freiheit von ihnen erlangen – ein Ziel, das weder rein naturwissenschaftlich noch bloß durch einfühlendes Verstehen erreichbar wäre. Psychoanalyse ist in dieser Sicht kritische Wissenschaft durch Selbstreflexion, eine Form aufgeklärter Hermeneutik, die Machtverhältnisse (innere und äußere) aufdeckt und aufhebt.
Dem widersprach Adolf Grünbaum (1984) in seiner bekannten Kritik. Er insistierte darauf, dass Freuds Theorien empirische Wahrheitsansprüche stellen – etwa die Behauptung, jede hysterische Symptomatik resultiere aus verdrängten sexuellen Konflikten – und dass solche Ansprüche sich an experimentellen Kriterien messen lassen müssten. Grünbaum bemängelte, Freud habe im therapeutischen Kontext seine Hypothesen überbestätigt, ohne die Möglichkeit von Suggestion oder anderen Störfaktoren auszuschließen. So habe Freud sich auf den sogenannten Tallieschluss verlassen: Ein Symptom, das verschwindet, sobald der Patient die zugrundeliegende unbewusste Wahrheit einsieht, solle die „Übereinstimmung mit der Realität“ (getallied) belegen. Laut Grünbaum könne symptomatische Besserung jedoch vielfältige Ursachen haben und stelle kein hinreichendes Kriterium für die Korrektheit einer Deutung dar. Die Psychoanalyse habe insofern bislang keine empirisch tragfähige Bestätigung ihrer Kernsätze erbracht und weiche von den Normen wissenschaftlicher Überprüfbarkeit ab.
Freud selbst war, wie angedeutet, zwiegespalten. Einerseits bezeichnete er seine Theorie als „Naturwissenschaft des Seelenlebens“ (Freud, 1933), andererseits sah er, dass die üblichen Methoden (quantitatives Messen, objektive Distanz) im Feld des Seelischen nicht ohne Weiteres greifen (Freud, 1930). Seine Schriften sind zugleich von hermeneutischen Wendungen durchzogen: Träume, Symptome, Versprecher werden wie Texte interpretiert, deren verborgene Bedeutung es zu entschlüsseln gilt. Paul Ricœur (1965) hat dies auf die Formel gebracht, Freud sei ein „Hermeneutiker des Verdachts“ – jemand, der hinter dem Manifesten einen tieferen, verschleierten Sinn aufspüre. Dieser Verdacht, dass nichts für bare Münze genommen werden dürfe, teilt Freud mit Nietzsche und Marx (Ricœur, 1965). Es gehe ihm, so Ricœur, nicht um ein naives Einfühlen, sondern um ein kritisches Durchschauen von Verzerrungen und Rätseln.
Diese Spannung zwischen Erklärungsanspruch und Verstehensprozess markiert die einzigartige Position der Psychoanalyse. Freud (1933) betonte die Radikalität seines Anspruchs: Er habe etwas entdeckt, „ohne das man nichts Wichtiges über den Geist verstehen kann“, und nur er kenne die adäquate Methode. Während Gegner diese Haltung als überzogen kritisieren, versuchten Sympathisanten oft, Freud entweder naturwissenschaftlich oder hermeneutisch zu rechtfertigen, so Vassalli (2001). Doch Psychoanalyse ist vielmehr eine eigenständige Erkenntnisform, die sich weder im klassischen Experiment noch in reiner Textinterpretation erschöpft.
Negative Hermeneutik: Verstehen des Unverstehbaren
Um diese eigene Erkenntnisform zu erfassen, hilft der Begriff der negativen Hermeneutik. Hermeneutik allgemein bezeichnet die Kunst des Verstehens und Interpretierens von Bedeutungen (Gadamer, 1960). Eine negative Hermeneutiklenkt den Blick hingegen auf die Grenzen des Verstehens, auf Lücken, Widerstände und Brüche (vgl. Warsitz & Küchenhoff, 2015). Sie forscht im Halbdunkel des Nicht-Gesagten und scheinbar Unsinnigen – in dem „dunklen“ Teil des Seelenlebens, der sich einer bewussten Verständigung entzieht (Freud, 1900, 1930). Verdrängte Vorstellungen oder Affekte, die dem Bewusstsein entzogen bleiben, wirken nach wie vor, erscheinen aber nur als negative Präsenz (Freud, 1915).
Die Psychoanalyse entwickelt hierfür eine Semiotik des Fehlenden (Warsitz & Küchenhoff, 2015): Während der Patient frei assoziiert, versetzt sich der Analytiker in einen Zustand der Rêverie, einer wachen, träumerischen Offenheit (Bion, 1962). So wird das Ungesagte indirekt wahrnehmbar, etwa durch plötzlich aufsteigende Bilder oder Stimmungen im Analytiker (Gadamer, 1960; Lorenzer, 1986). Die freie Assoziation des Patienten und die gleichschwebende Aufmerksamkeit (bzw. Rêverie) des Analytikers bilden methodische Korrespondenzregeln, um die Zensur des Bewusstseins zu umgehen (Freud, 1900). Jeder Einfall, jeder Versprecher, ja selbst das Schweigen gilt als Bedeutungsindiz, weil das Unbewusste nach Freud (1900) einer „unbewussten Syntax“ folgt (Lacan, 1964/1978). Jedes Symptom ist polykausal bzw. überdeterminiert, sodass die Deutung in Schichten erfolgt (Freud, 1917).
Der Prozess der Erkenntnis entfaltet sich dialektisch: Im Dialog zwischen bewusster Selbstdarstellung und unbewusster Enthüllung kristallisieren sich Deutungen heraus, die Widerstände (Freud, 1917) durchbrechen müssen. Ogden (1992) spricht dabei von einem „fundamental dialektisch konstituierten Subjekt“ (S. 517), das von Gegenwart und Abwesenheit geprägt ist. Der Analytiker achtet gezielt auf Lücken und Widersprüche, da sie auf das verweisen, was der Patient nicht sagen kann. Aus philosophischer Sicht ließe sich dies als regulative Idee (Kant, 1787/1956) beschreiben: Das Unbewusste fungiert als Leitidee, die disparate Phänomene (Symptome, Träume, Versprecher) auf einen verborgenen Sinnzusammenhang verweist, ohne selbst empirisch greifbar zu sein (Freud, 1933; Ricœur, 1965).
Negative Hermeneutik erfordert somit die Kultivierung von Nicht-Wissen (Bion, 1962). Man fragt nicht vorschnell, was etwas bedeutet, sondern hält das Unverstehen aus, bis sich im Prozess ein stimmiges Deutungsgefüge abzeichnet (Habermas, 1968/1973; Lorenzer, 1972, 1986). Gerade das wiederholte „Scheitern“ an einer Bedeutung gilt als Hinweis auf das Verdrängte. Verstehen ist hier also das Resultat eines konflikthaften Durcharbeitens (Freud, 1917): Nur indem Widerstände inszeniert und überwunden werden, entsteht neues Bedeutungswissen – und zwar im zwischenmenschlichen Raum (Übertragungs-Gegenübertragungsfeld, szenisches Verstehen).
Alfred Lorenzer (1986) prägte dafür den Begriff des szenischen Verstehens, weil das Unbewusste sich im Hier-und-Jetzt der Beziehung performativ inszeniert. Oft ist dies verbunden mit Sprachzerstörung und -rekonstruktion: Traumatische Erfahrungen führen zu einer Art sprachlichem Blackout, der in der Analyse erst allmählich rückübersetzt werden kann (Lorenzer, 1972). Bions (1962) Beta-Elemente, die der unverdauten Erfahrung entsprechen, brauchen die empathisch-träumende Resonanz (Rêverie) des Analytikers, um zu Alpha-Elementen zu werden – also zu „Symbolen“, die sprachlich und gedanklich verarbeitet werden können.
Insofern heißt negative Hermeneutik auch: Geduld mit dem Nicht-Verstehen. Anders als positivistische Wissenschaftsansätze, die Unklarheiten schnell beseitigen möchten, kultiviert die Psychoanalyse eine Schwebehaltung: Ohne Gedächtnis und ohne Verlangen (Bion, 1962). Dieses Paradox – etwas verstehen zu wollen, was sich entzieht – ist konstitutiv. Freud (1900) postulierte, dass das Unbewusste niemals voll bewusst wird; immer bleibt ein Kern unverfügbar (vgl. Freud, 1933).
In Lacans (1964/1978) Terminologie korrespondiert dieser Kern mit dem Realem, das sich im Symbolischen nur als Lücke äußert. Die Psychoanalyse folgt den Spuren dieses Realen (Verhaeghe, 2002), das sich offenbart, wo etwas „nicht funktioniert“ (Lacan, 1964/1978): eine Störung, ein Symptom, ein Bruch. An solchen Stellen drängt sich unbewusste Wahrheit auf, die im bewussten Diskurs keinen Platz fand. Lacan (1964/1978) beschreibt den Vorgang als „Scheitern des Symbolischen“, das neue Kompensationen (Symptome) erzwingt. Negative Hermeneutik sucht dieses Scheitern zu entziffern und darin den ursprünglichen Konflikt zu erkennen.
Methodologische Herausforderungen und Fallbeispiel
Angesichts dieser Charakteristika – indirekte Erschließung, dialogische Dialektik, negativer Fokus – entstehen erhebliche methodologische Herausforderungen. Erstens entzieht sich der Untersuchungsgegenstand (subjektive Äußerungen, Träume, Erinnerungen) einer einfachen Objektivierung (Freud, 1905, 1915; Lorenzer, 1986). Zweitens ist der Analytiker kein neutraler Beobachter, sondern Teil des Feldes (Bion, 1962; Ogden, 1992). Seine Gegenübertragung wird zum Erkenntnismedium, birgt jedoch auch Verzerrungsrisiken. Drittens stellt sich die Frage, wie Deutungen validiert werden können (Habermas, 1968/1973). Die Psychoanalyse antwortet mit prozessualer Validierung: Eine Deutung „bewährt“ sich, wenn der Patient sie affektiv annimmt und eine tiefgreifende Veränderung erlebt – eine Form weicher Evidenz statt harter Falsifikation (Grünbaum, 1984).
Viertens bleibt die Kommunizierbarkeit und Generalisierbarkeit psychoanalytischer Erkenntnisse schwierig (Freud, 1933). Zwar versuchte Freud aus Einzelfällen universelle Theoreme (Ödipuskomplex, Strukturmodell) abzuleiten, doch sind Theorie und Kasuistik eng verwoben (Freud, 1895, 1900). Spätere Ansätze reichten von empirisch-statistischen Studien (einige Einzelfallforschungen) bis hin zu geisteswissenschaftlichen Methoden (Kultur- und Literaturanalysen, vgl. Ricœur, 1965; Lorenzer, 1972). Die Spannbreite verdeutlicht die methodische Offenheit. Warsitz und Küchenhoff (2015) argumentieren, psychoanalytisches Wissen entstehe gerade aus dieser Konfrontation mit dem Nicht-Wissen, in einem interaktiven Aushandlungsprozess, der nicht formalisierbar sei, aber prinzipiell rekonstruierbar.
Ein klinisches Beispiel verdeutlicht das: Angenommen, Herr M. (Mitte dreißig) kommt wegen Depression und Beziehungsschwierigkeiten in Analyse. Er wirkt betont rational, ohne Affekte. Der Analytiker fühlt in sich unerklärliche Traurigkeit. Hypothese: Das eigentlich Wichtige ist das, was M nicht sagt. Nach mehreren Sitzungen erinnert M plötzlich einen Traum von einem dunklen Haus mit verschlossener Tür und Weinen dahinter. Dies führt zu einer Kindheitsszene (verdrängtes Trauma): Als Achtjähriger fand er seine kollabierte Mutter, sprach jedoch nie darüber. Die Depression rührt von unbetrauerter Angst und Wut. Erst durch das negative hermeneutische Vorgehen – Aushalten der Leere, Suchen des Unsagbaren, Warten auf Bilder und Träume – konnte sich dieser Kern enthüllen. Aus klassisch naturwissenschaftlicher Perspektive wäre kaum zu erkennen gewesen, dass M’s Symptome hier wurzeln. Eine vorschnelle Deutung hätte Abwehr ausgelöst. Negative Hermeneutik hingegen ließ das Verdrängte an die Oberfläche treten.
Dies illustriert auch das erweiterte Kausalverständnis der Psychoanalyse (Freud, 1933; Bion, 1962). Gemäß Aristoteles unterscheidet man: causa materialis, causa efficiens, causa formalis, causa finalis. Psychoanalytisch liegen die „Materialursachen“ u. a. in der biologischen und familiären Konstitution, die „Wirkursachen“ sind lebensgeschichtliche Ereignisse (z. B. das Trauma). Die „Formursachen“ sind die unbewussten Strukturen (Abwehrmechanismen, Über-Ich), und die „Zweckursachen“ liegen im Symptomzweck (Schutz vor überwältigenden Gefühlen). Moderne Diskurse wie Neuropsychoanalyse verbinden diese Ebenen (vgl. Verhaeghe, 2002). Doch der erkenntnistheoretische Kern bleibt die negative Hermeneutik des Unbewussten, die auf verborgene Sinnhaftigkeit zielt (Ricœur, 1965; Lorenzer, 1986).
Erkenntnistheoretische Eigenart der Psychoanalyse
Die Psychoanalyse erweist sich insgesamt als hermeneutische Wissenschaft sui generis. Sie produziert Wissen über etwas, das sich der direkten Beobachtung entzieht (Freud, 1900, 1917). Dieses Paradox wird aufgelöst, indem im interaktiven Prozess zwischen Analytiker und Patient Deutungen entstehen, welche das Verborgene teilweise erschließen (Habermas, 1968/1973). Die negative Hermeneutik beschreibt den Fokus auf das Unverfügbare, das nicht schon Verstandene. Daraus erwachsen andere Validitätskriterien als in den Naturwissenschaften: Wahrheit zeigt sich in der Kohärenz und Wirkung einer Deutung im Leben der Analysierten (Freud, 1933; Lorenzer, 1986; Ogden, 1992).
Diese pragmatische Wahrheit (etwas wird „wahr“, indem es heilt und integriert) unterscheidet sich von experimenteller Falsifikation (Grünbaum, 1984). Psychoanalytische Theoriebildung bleibt heuristisch, wie Freud selbst betonte („Metapsychologie als Schachfiguren“, Freud, 1933). Lacan (1964/1978) arbeitete dies sprachtheoretisch aus: Das Reale wird nie vollständig eingefangen, das Unbewusste bleibt ein Gleitendes. Die Kunst liegt darin, in jedem Fall neu zu finden, was in Lücken und Brüchen symbolisiert werden kann. Dementsprechend ist die Psychoanalyse weder streng empiristisch noch reine Hermeneutik, sondern eine Techné im antiken Sinne (Habermas, 1968/1973; Vassalli, 2001), eine Kunstlehre, die methodische Regeln (Freie Assoziation, Deutung, Durcharbeiten) praktisch umsetzt, um im Dunkeln „Bauten“ zu errichten (Freud, 1915, 1933).
Die Kennzeichnung als negative Hermeneutik führt zuletzt zu einer ethischen Dimension: Das Anerkennen des Unverfügbaren erfordert Respekt vor dem Fremden im Selbst (Freud, 1900; Gadamer, 1960). Diese Haltung zielt darauf, leidvolles Nicht-Verstehen zu mildern, ohne alles restlos aufzuklären. Psychoanalytische Erkenntnis baut im Dunkeln und hinterlässt Gebilde, die nicht in blendendem Licht stehen, aber dem Subjekt ein authentischeres Leben erlauben. Gerade hierin besteht ihr Beitrag zum wissenschaftlichen Kanon: Sie verschiebt die Erkenntnisdefinition, indem sie Nicht-Wissen zum Ausgangspunkt einer tieferen Einsicht macht (Ricœur, 1965; Lorenzer, 1986; Warsitz & Küchenhoff, 2015).
Literaturverzeichnis (APA)
Bion, W. R. (1962). Learning from Experience. London, UK: Heinemann.
Dilthey, W. (1883). Einleitung in die Geisteswissenschaften. Leipzig, Germany: Duncker & Humblot.
Freud, S. (1895). Studien über Hysterie (mit J. Breuer). In Gesammelte Werke (Bd. I). London, UK: Imago.
Freud, S. (1900). Die Traumdeutung. In Gesammelte Werke (Bd. II/III). London, UK: Imago.
Freud, S. (1905). Fragment einer Analyse der Hysterie („Dora“). In Gesammelte Werke (Bd. V). London, UK: Imago.
Freud, S. (1915). Metapsychologische Schriften. In Gesammelte Werke (Bd. X). London, UK: Imago.
Freud, S. (1917). Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. In Gesammelte Werke (Bd. XI). London, UK: Imago.
Freud, S. (1930). Brieflicher Hinweis, dass es innerhalb psychoanalytischer Methoden keinen Platz für das physikalische Experiment gibt. Verfügbar unter ebrary.net
Freud, S. (1933). Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. In Gesammelte Werke (Bd. XV). London, UK: Imago.
Gadamer, H.-G. (1960). Wahrheit und Methode. Tübingen, Germany: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Grünbaum, A. (1984). The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique. Berkeley, CA: University of California Press.
Habermas, J. (1968/1973). Erkenntnis und Interesse. Frankfurt am Main, Germany: Suhrkamp.
(Siehe auch Diskussion zur Wissenschaftsnatur der Psychoanalyse unter publishing.cdlib.org.)
Kant, I. (1787/1956). Kritik der reinen Vernunft. In Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden (hrsg. von Wilhelm Weischedel). Darmstadt, Germany: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Lacan, J. (1964/1978). Seminar XI: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse (Französisches Original 1964; dt. Übers. 1978). Verschiedene Ausgaben; vgl. paulverhaeghe.psychoanalysis.be.
Lorenzer, A. (1972). Zur Begründung einer materialistischen Sozialisationstheorie. Frankfurt am Main, Germany: Suhrkamp.
Lorenzer, A. (1986). Szenisches Verstehen. Zur Wissenschaftslogik psychoanalytischer Erkenntnis. Frankfurt am Main, Germany: Suhrkamp.
Ogden, T. H. (1992). The Dialectically Constituted/Decentered Subject of Psychoanalysis. The International Journal of Psychoanalysis, 73, 517–526.
Abgerufen von https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Ricœur, P. (1965). De l’interprétation. Essai sur Freud. Paris, France: Seuil.
Vassalli, G. (2001). Einblicke in Freuds negative Erkenntniskunst. Verfügbar unter ebrary.net
Verhaeghe, P. (2002). Über das Schicksal des Lacan’schen Realen in der klinischen Arbeit. Vgl. https://paulverhaeghe.psychoanalysis.be
Warsitz, R.-P., & Küchenhoff, J. (Hrsg.). (2015). Psychoanalyse als Erkenntnistheorie: psychoanalytische Erkenntnisverfahren. Stuttgart, Germany: Kohlhammer.
Windelband, W. (1894). Geschichte und Naturwissenschaft. Rede, gehalten bei Antritt des Rektorats der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg. Heidelberg, Germany: Winter.